|
Diese
zeitgenössische Grafik erklärt, wie die
Rohstoffversorgung der
Schwerindustrie im saarländisch-lothringischen
Raum funktionierte.
Mehr
zur Kohleförderung finden Sie auf unserer Seite
über den Bergbau
im Saarland.
3) L‘administration
séquestre: Industrie unter Zwangsverwaltung
(Text:
Karl Presser)
Unmittelbar
nach
Kriegsende stellte das französische Militär rund
60 saarländische
Unternehmen unter Zwangsverwaltung. Diese gehörten
überwiegend zu den Bereichen
Schwerindustrie und metallverarbeitende Industrie
(wie etwa Ehrhardt & Sehmer in Saarbrücken).
Unter „administration séquestre“ wurden alle Banken,
die Versicherungen und selbst Kinos gestellt (siehe hierzu „UT-Kino“
auf der Kino-Seite). Auch die
Saargruben AG stand bis zur Gründung der Régie des
Mines de la Sarre am 1.
Januar 1948 unter Zwangsverwaltung. Diesen
unschönen Begriff verwendete man
indessen selten; man ersetzte ihn lieber durch
"administration séquestre“.
Die offizielle Bezeichnung der Völklinger Hütte
lautete beispielsweise
„Administration Séquestre der Röchling’schen
Eisen- und Stahlwerke GmbH“. Wie
man sieht, hatte die Sequesterverwaltung auf die
handelsrechtliche
Unternehmensform, hier GmbH, keinerlei
Auswirkungen. Bis Ende 1947 war mehr als
die Hälfte der saarländischen Arbeitnehmer,
Bergleute eingeschlossen, in
Betrieben beschäftigt, die
unter „administration
séquestre“ standen.
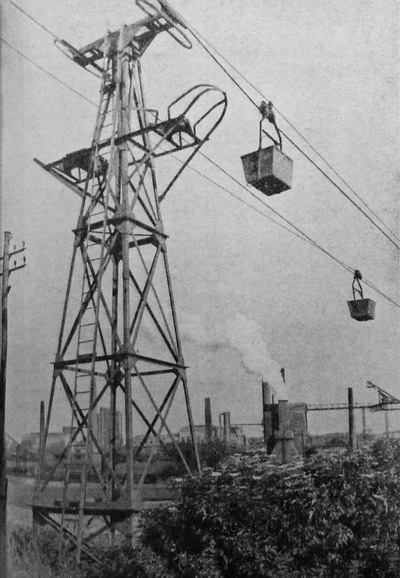 Das
Hohe Kommissariat unter Grandval hatte eine eigene
Abteilung für
Sequesterverwaltungen. Deren „Directeur Général“
war Frédéric Schlachter.
Er gehörte zum Kreis der Remigranten mit
französischem Pass, die jetzt im
Saarland erfolgreich agieren konnten. Er hieß eigentlich
Friedrich Wilhelm mit Vornamen, war 1892 in Kirn
an der Nahe geboren und 1935
nach Frankreich emigriert. Er gab sich als wahrer
Tausendsassa. Nacheinander
und teilweise gleichzeitig war er Leiter der
Entnazifizierungsbehörde, Mitglied
im Direktionskomitee der Régie des Mines,
Mitbegründer der Werbeagentur SARAG,
Generaldirektor der „Saarländischen
Vermögensverwaltung“, Präsident des
Aufsichtsrats der Saarländischer Rundfunk GmbH und
Präsident, danach
Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer zu
Saarbrücken. Er galt als
„graue Eminenz“ im Saarstaat und wurde 1950 als
Nachfolger in Personalunion von
Wirtschaftsminister Singer und von Finanzminister
Grommes gehandelt, wie der
Spiegel am 25.5.1950 zu wissen glaubte. Da
Schlachter offenbar argwöhnte, die
Saarländer könnten ihm irgendwann den „Frédéric“
übel nehmen, publizierte er
bereits ab 1948 wieder als Friedrich Schlachter
und unterschrieb am liebsten
ohne Vornamen. Adolf Blind, ab 1955
Finanzminister, war über Schlachters
Kompetenz
in Wirtschaftsfragen „sehr im Zweifel“. Johannes
Hoffmann offenbar auch, denn er berief ihn wider
Erwarten im
April 1951 nicht
in sein zweites Kabinett. Das
Hohe Kommissariat unter Grandval hatte eine eigene
Abteilung für
Sequesterverwaltungen. Deren „Directeur Général“
war Frédéric Schlachter.
Er gehörte zum Kreis der Remigranten mit
französischem Pass, die jetzt im
Saarland erfolgreich agieren konnten. Er hieß eigentlich
Friedrich Wilhelm mit Vornamen, war 1892 in Kirn
an der Nahe geboren und 1935
nach Frankreich emigriert. Er gab sich als wahrer
Tausendsassa. Nacheinander
und teilweise gleichzeitig war er Leiter der
Entnazifizierungsbehörde, Mitglied
im Direktionskomitee der Régie des Mines,
Mitbegründer der Werbeagentur SARAG,
Generaldirektor der „Saarländischen
Vermögensverwaltung“, Präsident des
Aufsichtsrats der Saarländischer Rundfunk GmbH und
Präsident, danach
Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer zu
Saarbrücken. Er galt als
„graue Eminenz“ im Saarstaat und wurde 1950 als
Nachfolger in Personalunion von
Wirtschaftsminister Singer und von Finanzminister
Grommes gehandelt, wie der
Spiegel am 25.5.1950 zu wissen glaubte. Da
Schlachter offenbar argwöhnte, die
Saarländer könnten ihm irgendwann den „Frédéric“
übel nehmen, publizierte er
bereits ab 1948 wieder als Friedrich Schlachter
und unterschrieb am liebsten
ohne Vornamen. Adolf Blind, ab 1955
Finanzminister, war über Schlachters
Kompetenz
in Wirtschaftsfragen „sehr im Zweifel“. Johannes
Hoffmann offenbar auch, denn er berief ihn wider
Erwarten im
April 1951 nicht
in sein zweites Kabinett.
Die
jeweils eingesetzten Sequesterverwalter agierten in
„ihren“ Unternehmen meist
als Generaldirektoren. Sie waren von sehr
unterschiedlicher fachlicher und
sozialer Kompetenz. (Siehe hierzu auch den
Beitrag über das Bouser Röhrenwerk).
Kurz nach der Gründung
des Saarlandes erfolgte 1948 eine Neuordnung der
Sequestrierung. Die
saarländische Regierung errichtete ein Amt für
Vermögensverwaltung. In seine
Zuständigkeit fielen ehemaliges Reichs-
und NSDAP-Vermögen sowie die Verantwortung für
bestimmte öffentlich-rechtliche
und gemischt-wirtschaftliche Unternehmen
(Staatsbeteiligungen).
Die
Anzahl der sequestrierten Unternehmen ging im
Laufe der Zeit zurück. Im
Saarstatut von 1954 wurde schließlich der völlige
Fortfall der
Zwangsverwaltung vorgesehen. (Die beiden Fotos oben sind
aus der Zeitschrift Zeit im Bild, Nr.11, März
1947)
.
Zuvor
hatten sich die neuen Machthaber einfacher, aber
erfolgreicher
bilanztechnischer
Tricks bedient: Unternehmen mit französischen
Minderheitseignern
bekamen aus
Paris hohe Reparationsforderungen in Rechnung
gestellt. Diese wurden
nicht
wirklich gezahlt, sondern auf der einen Seite den
französischen
Minderheitseignern zugerechnet und auf der anderen
Seite vom deutschen
Firmenanteil abgezogen. So entstand bilanziell die
gewünschte
französische
Kapitalmehrheit am Unternehmen, und es konnte
damit französisches oder
frankophiles Führunspersonal berufen werden. Eine
weitere Variante war
die Übernahme durch Fusion von saarländischen mit
französischen
Unternehmen. Die Dillinger Hütte wurde so 1948
zusammen mit
französischen Werken zur SOLLAC (Société Lorraine
de Laminage Continu)
verschmolzen. Dieses Vorgehen war keineswegs im
Sinne der mit
Amerikanern und Briten gemeinsam getroffenen
Reparationsvereinbarungen. Beschwerten sich die
alten Eigentümer über
die
kreativen Methoden der Franzosen, konnten oder
wollten jedoch weder
Amerikaner
noch Briten dagegen einschreiten.
|

|
Für
die Hütten in Neunkirchen
und Völklingen schätzten die Franzosen
dieses Vorgehen als chancenlos
ein. Es
gab dort so gut wie kein Fremdkapital. Die
alten Eigentümer beider
Werke zeigten sich zudem hartnäckig, wenn es
um die Aufgabe von
Ansprüchen ging.
Im
Juni 1945 wurde Georges Thédrel als
Sequesterverwalter und Generaldirektor in
Völklingen
eingesetzt. Er war ein anerkannter Fachmann
und hatte auf dem Gebiet des
Eisenhüttenwesens langjährige Erfahrung. Ihm
war von Anfang an klar, dass er
ohne das auf den Hütten noch vorhandene
Führungspersonal nur geringe Chancen
hatte, die Anlagen wieder anzufahren. Er
degradierte deshalb viele
Führungskräfte, auch wenn ihnen keine
Verbrechen nachzuweisen waren, zu
Arbeitern, beließ sie aber trotzdem in den
alten Funktionen. 1948 wurden fast
alle von dieser Maßnahme Betroffenen
amnestiert. Im gleichen Jahr wurde Thédrel
zusätzlich zum Sequesterverwalter des
Neunkircher Eisenwerks bestimmt. (Foto: Archiv
d.Saarstahl AG)
|
|
Thédrels
Problem war, dass er kaum Mittel für
notwendige Investitionen aus Paris
bekam. Die Gelder, die Frankreich aus dem
Marshall-Plan für die
Hüttenindustrie zur
Verfügung gestellt wurden, flossen nur zu
5% ins Saarland, obwohl der
Anteil
der Saarhütten an der
Gesamt-Produktionsmenge im gemeinsamen
Wirtschaftsraum
20% betrug. Das Geld wurde vorwiegend bei
den lothringischen
Wettbewerbern investiert.
Unter
den gegebenen Randbedingungen ist es
Thédrel umso höher anzurechnen, dass er
einerseits die volle Inbetriebnahme des
Neunkircher Eisenwerks bis Ende 1950
aus Marshall-Plan-Mitteln durchsetzte.
Andererseits begann er 1952 mit der
Verlegung der Saar in Völklingen und ab
1954 mit dem damit möglichen Bau eines
dringend benötigten neuen Walzwerkes.
Rechts:
Mme Grandval spielte eine "zündende" Rolle
beim Wiederanstich im Neunkircher
Eisenwerk am 15. Juli 1950.
|

(Foto:
Landesarchiv Saarbrücken, Presse
Foto-Actuelle)
|
|
Erst
am 28.11.1956 wurde die Völklinger Hütte
als letztes
saarländisches Unternehmen aus der
Zwangsverwaltung entlassen und an die
Familie Röchling zurückgegeben. Die
Feineisenstraße im Nauweiler Gewann, mit
deren Bau Thédrel begonnen hatte, nahm am
29.5.1957 den Betrieb auf.
|
|
4)
Die
Montanunion
(Europäische
Gemeinschaft für Kohle und
Stahl - EGKS)
In
Deutschland war - ebenso wie in Frankreich
und dem ihm wirtschaftlich
angeschlossenen Saarland - nach dem Krieg
ein erfolgreicher Neustart der
Montanindustrie lebenswichtig. In Frankreich
hatte man ein zentrales
Planungsamt für den Wiederaufbau
eingerichtet, dessen Leitung Jean Monnet
inne
hatte. Dieser hatte klar erkannt, daß die
französischen Erzvorkommen
Lothringens
ohne eine ausreichende Versorgung mit
Kokskohle nur unzureichend
ausgebeutet werden
konnten. Geeignete Kohlevorkommen lagen
allerdings außerhalb
Frankreichs, und zwar einerseits in der
britischen Zone im Ruhrgebiet
und andererseits im Saarland.
Monnet
entwickelte einen Plan für die übernationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit der
Montanindustrie in
Europa. Dabei spielte das Saarland als Teil
des französischen Wirtschaftsraums
eine besondere Rolle, denn nur unter
Berücksichtigung seiner Kohlevorkommen
konnte
Frankreich bei einer geplanten
Zusammenarbeit eine starke Position im
Montanbereich einnehmen.
Robert
Schuman als Frankreichs Außenminister
betrieb die
politische Umsetzung des später nach ihm
benannten “Schuman-Plans“. Jean Monnet wurde
Verhandlungsführer bei der
Konferenz, die zur Gründung der ‘Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (EGKS)
führte. Die Verträge wurden am 18. April
1951 in Paris unterzeichnet
und traten am 23. Juli 1952 für die Dauer
von 50 Jahren in Kraft.
Umgangssprachlich
ist die EGKS besser als Hohe
Behörde “Montanunion“ bekannt.
Monnet wurde ihr erster Präsident. Sie
stellte eine
gemeinsame Kontrolle der Montanindustrie in
den Gründungsstaaten Deutschland,
Frankreich, Italien und den BENELUX-Ländern
unter Wegfall von Zöllen sicher.
|
______________________________________________
Verwendete
Publikationen zu den obigen Texten:
Schneider,
Dieter Marc. Saarpolitik und Exil 1933-1955.
Vierteljahreshefte für
Zeitgeschichte. 1977, 4. Heft Oktober. Seite 543.
Blind, Adolf. Unruhige
Jahre an der Saar 1947 bis
1957. Bd. 1. Quo
vadis, Saarland? Frankfurt am Main. 1956.
Saarländisches
Industrie- und Handelsadressbuch 1949. L. L.
Kreutz Industrie-Verlag GmbH,
Saarbrücken
Müller,
Heinrich in: Völklinger Nachkriegsjahre 1945-1956
Teil 2, Harrer Druck GmbH, Völklingen, Juli 1998
Der
Spiegel vom 09.03.1950: Saar Wirtschaft - Nichts
zu sagen (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44447687.html
)
Der
Spiegel vom 25.05.1950: Saar-Industrie - Sanfter
Druck
(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44448458.html
)
|