|
oben
|
2) V o l k s b e f r a g u n g
über das Saarstatut am 23. Oktober 1955
und Abstimmungskampf
 2) Consultation populaire et combat acharné lors du référendum du 2) Consultation populaire et combat acharné lors du référendum du
23 octobre 1955
sur le statut de la Sarre.- La traduction française du
texte de ce chapitre se trouve tout en bas de cette page.)
|
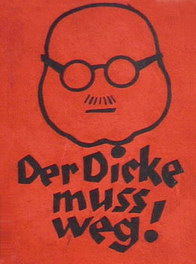
(> Infos über diesen und
viele weitere Aufkleber)
|
|
Inhalt dieser Seite: a) Das Gesetz b) Die Parteien c)
Der Abstimmungskampf d) Zweigeteiltes Land
e) CDU-Konflikt f) War es eine 'Volksbefragung' oder eine 'Volksabstimmung'?
Über das Ergebnis und die Folgen der Volksbefragung lesen Sie bitte auf unserer Seite > Ergebnisse & Folgen.
|
|
Bundeskanzler
Adenauer und der französische Ministerpräsident Mendès France hatten
1954 das "Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik über das Statut der Saar"
(kurz: Saarstatut) ausgehandelt und am 23. Oktober 1954 unterzeichnet. Es sah im Wesentlichen eine Europäisierung des Saarlandes vor, das unter Beibehaltung der Wirtschaftsunion mit Frankreich
zu einem supranationalen, also außerstaatlichen
Territorium
werden sollte. Es hätte zum Sitz der Montanunion werden und später
weitere europäische Behörden beherbergen sollen. So hätte es sich zum Grundstein einer künftigen europäischen Staatengemeinschaft entwickeln können.
Einzelheiten über diese Vorgänge und die politischen Zusammenhänge finden Sie auf unserer Seite Das Saarstatut, die in die folgenden drei Teile aufgegliedert ist:
A) Wie das Saarstatut zustande kam, B) die Folgen für das Saarland bei der Annahme
des Statuts, C) Vollständiger Wortlaut des Statuts.
|
|
a) Das Gesetz betreffend die Durchführung der Volksbefragung
(VBG, Gesetz Nr. 457)
Als Voraussetzung für das Inkrafttreten des Saarstatuts war in seinem Artikel I festgelegt, dass es zunächst "im Wege einer Volksab-stimmung" gebilligt werden musste. Für deren Durchführung
wurde ein Gesetz erlassen.
Es wurde am 8. Juli 1955 vom Landtag des
Saarlandes beschlossen und trat am 23. Juli in Kraft, also genau drei
Monate vor dem Termin der Volksbefragung, wie im Artikel X des Statuts vorgeschrieben.
Das Gesetz [1] regelte sämtliche Details der Volksbefragung. In
§ 15 (1) bestimmte es z.B., dass die Abstimmungsberechtigten das 20.
Lebensjahr vollendet haben mussten; sie mussten also mindestens 21
Jahre alt sein.
|
|
Weiterhin wurde in dem Gesetz u.a. festgelegt, dass die Volksbefragung allgemein, gleich, geheim und frei
sein musste. Es enthielt auch Anordnungen über Stimmbezirke und
Stimmlisten, über das Stimmrecht, die Auszählungsmodi sowie die
Feststellung der
Ergebnisse,
u.v.m.
Auch
bezüglich des Abstimmungskampfes ergingen ausführliche Regelungen, z.B.
über die Presse, über Flugblätter, Aufschriften und über Plakate
politischen Charakters. Öffentliche politische Versammlungen waren von
nun an erlaubt, nicht aber solche unter freiem Himmel sowie "politische
Aufzüge". Verboten wurden auch Lautsprecher auf öffentlichen Plätzen
und Straßen.
Rundfunk und Fernsehen
durften keiner Partei Sendezeit zur Verfügung stellen, und eigene
Berichte der Sender über den Ablauf des Abstimmungskampfes und der
Abstimmung mussten neutral gehalten sein.
|

Foto: LA Saarbrücken, Actuelle-270
|
|
Alle
Parteivorsitzenden, sämtliche Herausgeber von Zeitungen und anderen
Druckerzeugnissen sowie alle Redner bei Kundgebungen mussten Personen
sein, die zur Teilnahme an der Volksbefragung zugelassen, also
stimmberechtigt waren. Sämtliche Druckstücke, die verteilt oder
aufgehängt wurden, mussten im Saarland gedruckt worden sein und Angaben
über ihren Herausgeber und die Herstellerfirma enthalten. Mit diesen
Maßnahmen sollte eine Beeinflussung des Abstimmungskampfs durch
Wahlpropaganda aus dem Ausland, besonders aus der Bundesrepublik,
verhindert werden.
Aber
trotz aller Verbote erreichten umfangreiche Propaganda-Materialien aus
der Bundesrepublik die saarländische Bevölkerung. Sie wurden über die
deutsch-saarländische Grenze geschmuggelt und heimlich verteilt.
Zeitungen, Flugblätter und Streitschriften gegen die Annahme des
Saarstatuts wurden bei Nacht und Nebel an vorher abgesprochenen Stellen
mit Autos herangeschafft oder aus fahrenden Zügen geworfen und von dort
wartenden Helfern aufgelesen. Dafür eigneten sich besonders gut Wälder
und abgelegene Felder. Am nächsten Tag wurde das Material in den
Dörfern und Städten verteilt.
Zeitzeugenbericht von Werner Resch, Saarlouis: Wenn ich in Saar-Nostalgie lese, muss ich oft an meine Zeit im Saarbataillon
denken, z.B. als unsere Einheit eingesetzt war, um an der deutschen
Grenze Flugblätter abzufangen. Während einer nächtlichen Fahrradstreife
geriet ich mit einem Kollegen hinter Mimbach*) an ein Gehöft. Wir
fragten die Bäuerin nach dem Ort und erfuhren zu unserem Schrecken,
dass wir schon in Deutschland waren! Wenn das damals bekannt geworden
wäre... es hätte wohl diplomatische Verwicklungen gegeben.
*) damals ein Dorf nahe der saarländisch-deutschen Grenze, heute Stadtteil von Blieskastel
_________________
[1] Veröffentlicht im Amtsblatt des Saarlandes Nr. 87 vom 23. Juli 1955, S. 1024 ff. (siehe im Archiv der saarländischen Amtsblätter)
Weitere Einzelheiten zum Abstimmungskampf finden Sie weiter unten im Abschnitt c).
Mit welchen "Mitteln" die Parteien im Einzelnen kämpften, können Sie auf folgenden Seiten verfolgen:
Aufkleber und Zettel, Flugblätter, Karikaturen,
Plakate, Verse, Zeitungen
und Zeitungsartikel, Tumulte bei Kundgebungen.
|
|
b) Die Parteien
Mit dem Beginn des Abstimmungskampfes wurden gemäß den Bestimmungen des Saarstatuts (Artikel VI) die politischen Parteien sowie die
Vereine und die Zeitungen von der bis dahin bestehenden Genehmigungspflicht befreit.
Die dafür notwendigen neuen Vereins-, Versammlungs- und Pressegesetze [1] waren zusammen mit dem VBG (siehe oben unter a) am 8. Juli 1955 verabschiedet worden. Sie traten am 23. Juli in Kraft,
also drei Monate vor dem Tag der Volksbefragung, so wie es im Artikel X des Statuts vorgeschrieben war.
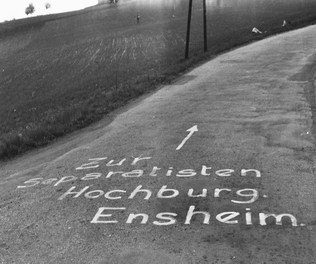 Dadurch konnten jetzt die bisher verbotene Demokratische Partei Saar (DPS) und die nicht zugelassenen Parteien CDU-Saar und Deutsche Sozialdemokratische Partei (DSP) erstmals unzensiert
an die Öffentlichkeit treten. Wegen der kurzen Zeitspanne bis zur
Volksbefragung mussten sie sich in aller Eile organisieren, Mittel zur
Finanzierung ihrer Aktivitäten besorgen und geeignete Presseorgane aus dem Boden stampfen. (Alle am Abstimmungskampf beteiligten Parteien und die Namen ihrer Vorsitzenden finden Sie in der Tabelle unten.) Dadurch konnten jetzt die bisher verbotene Demokratische Partei Saar (DPS) und die nicht zugelassenen Parteien CDU-Saar und Deutsche Sozialdemokratische Partei (DSP) erstmals unzensiert
an die Öffentlichkeit treten. Wegen der kurzen Zeitspanne bis zur
Volksbefragung mussten sie sich in aller Eile organisieren, Mittel zur
Finanzierung ihrer Aktivitäten besorgen und geeignete Presseorgane aus dem Boden stampfen. (Alle am Abstimmungskampf beteiligten Parteien und die Namen ihrer Vorsitzenden finden Sie in der Tabelle unten.)
Den Saarländern erschien diese neue Situation wie ein plötzlicher Ausbruch der Freiheit.
Nach zwanzig Jahren der Unterdrückung jeglicher freier Meinungsäußerung
waren jetzt plötzlich auch regierungsfeindliche Parteien zugelassen,
und jeder konnte offen äußern, was er dachte. Man durfte jetzt
tatsächlich gegen die
Regierung wettern, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.
Deutschlandfreundliche
Zeitungen konnten nun gedruckt werden, und in den Straßen hingen auch
die Plakate der pro-deutschen Parteien. Auf ihnen durften zum Beispiel
die Ja-Sager, die die Fortsetzung der Autonomie befürworteten,
ungestraft als "Separatisten" bezeichnet werden.
Das "Separatisten"-Foto wurde 1955 unten am Staffel aufgenommen (Straße von St.Ingbert nach Ensheim). (Foto: Gerd Schulthess)
Anmerkung zu dem Ausdruck "Separatist" (Anhänger einer Gebietsabtrennung, hier des Saarlandes von Deutschland): Tatsächlich
lag in Ensheim der Anteil der Ja-Stimmen am 23.10.1955 um ca. 10% höher
als im Landesdurchschnitt. - Der Ausdruck wurde im Saarland
auch schon vor dem Abstimmungskampf 1955 gebraucht, z.B. im Wahlkampf
um die Landtagswahl 1952. Die Kommunistische Partei schrieb damals in
einem Wahlaufruf: "Die Saar war, ist und bleibt deutsch! Keine Stimme
den Separatisten!"
Außer denjenigen Parteien, die erst am 23. Juli 1955 aus der Illegalität entlassen wurden (siehe oben), waren folgende schon seit 1946 zugelassene Parteien am Abstimmungskampf beteiligt:
Johannes
Hoffmanns CVP (Christliche Volkspartei) und Richard Kirns SPS
(Sozialdemokratische Partei des Saarlandes), sowie die Kommunistische
Partei, Landesverband Saar (KPS), Vorsitzender Fritz Bäsel. Während CVP
und SPS für die Annahme des Statuts waren, lehnte die KPS es
ab. Darin stimmte sie mit den nun legalisierten pro-deutschen Parteien
überein,
aber sie führte andere Argumente an als diese (siehe auch Seite Parteien). - Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Parteien und nennt auch einige kleinere Splittergruppen.
__________________
[1] Veröffentlicht im Amtsblatt des Saarlandes Nr. 87 vom 23. Juli 1955, S. 1030 ff.
|
|
Die
am Abstimmungskampf beteiligten Parteien und
ihre Vorsitzenden
|
|
"JA": FÜR das Saarstatut waren:
CVP (Christliche Volkspartei
des Saarlandes);
Johannes Hoffmann
SPS (Sozialdemokratische
Partei des Saarlandes);
Richard Kirn
Kleinere bzw. Splitterparteien:
FDP (Freie Deutsche Partei;
Info:
s. letztes Bild der Seite Plakate).
UAPS (Unabhängige
Arbeiterpartei Saar)
CSU-Saar (Christlich-Soziale
Union; Info
siehe hier.)
Arbeiter- u. Bauern-Partei Saar (s. Seite Aufkleber, ganz unten)
Europäische
Organisationen: [1]
EU (Europa-Union)
NEI (Nouvelles Équipes
Internationales oder
Gruppe Neues Europa)
Europa-Bewegung des Saarlandes (sie setzte sich mit Hilfe großformatiger
Zeitungsanzeigen für das Saarstatut ein.)
|
"NEIN": GEGEN das
Saarstatut kämpften:
a)
Die drei Heimatbundparteien (erst ab 8. Juli 1955 zugelassen)
CDU-Saar (Christlich-Demokratische Union
Saar); Dr.
Hubert Ney
DSP (Deutsche Sozialdemokratische
Partei); Kurt
Conrad
DPS (Demokratische
Partei Saar); Dr.Heinrich
Schneider
b)
Andere "Neinsager"-Parteien:
KP
bzw. KPS (Kommunistische Partei, Landesverband Saar);
(Fritz Bäsel)
DDU (Deutsche
Demokratische Union, linksgerichtet)
|
|
Welche Presseorgane (Zeitungen, Sonderblätter usw.) die einzelnen Parteien herausgaben, lesen Sie bitte auf der Seite Zeitungen.
|
|
[1] Die damals bestehenden europäischen Organisationen
waren zwar keine Parteien, wurden aber hinsichtlich der Benutzung von
Plakatanschlagtafeln wie politische
Parteien behandelt. (Amtsblatt des Saarlandes Nr. 88 vom 25. Juli 1955,
Seite 1053).
Eine
Darstellung aller im Saarstaat zwischen 1946 und 1959 tätigen Parteien,
ihrer Zielrichtung und ihres Werdegangs finden Sie auf der Seite Politische
Parteien.
|
|
c) Der Abstimmungskampf
begann offiziell am 23. Juli 1955. Seine Dauer war auf genau drei Monate festgesetzt. Er wurde, wie später auch die Abstimmung selbst, von der "Europäischen Kommission für das Saar-Referendum" überwacht. Diese war
am 16. Juni 1955 vom Ständigen Rat der Westeuropäischen Union (WEU)
eingesetzt worden. Ihr gehörten je ein Vertreter aus Belgien, England,
Italien, Holland und Luxemburg an, die den Belgier Fernand Dehousse
zu ihrem Vorsitzenden wählten.
Der damalige Abstimmungskampf ist mit heutigen Wahlkämpfen kaum zu vergleichen. Er verlief sehr leidenschaftlich. Es kam zu einem verbissenen Gefecht zwischen den "Ja-Sagern" und "Nein-Sagern", das mit Hilfe von Plakaten, Flugblättern und Aufklebern aller Art, in parteieigenen Presseorganen und bei Abstimmungskundgebungen ausgetragen wurde.
|
|
In den Zeitungen und Sonderblättern lieferten
sich die Parteien eine regelrechte journalistische "Schlammschlacht";
sie schreckten auch nicht vor Verunglimpfungen und Beleidigungen
zurück. (Eine ausführliche Aufstellung aller Zeitungen und Sonderblätter, die
am Abstimmungskampf teilnahmen, finden Sie, mit Original-Titelzeilen und weiteren Einzelheiten über die Blätter, auf der Seite Zeitungen.)
Beide Lager waren nicht zimperlich in der Wahl ihrer Mittel: Die Ja-Sager wurden als Separatisten
beschimpft, während die Vertreter der Neinsager-Parteien als
Nationalisten bezeichnet wurden, Heinrich Schneider (DPS) beschimpfte
man wegen seiner früheren NSDAP-Tätigkeit als Nazi. Beide Seiten
leisteten sich Ungerechtigkeiten und Entgleisungen, übertrieben oft
maßlos und scheuten sich nicht davor, Plakate und Klebezettel der gegnerischen Parteien
zu übermalen, zu überkleben oder abzureißen (siehe Bild und Text rechts und unten; weitere Infos dazu auf der Seite Plakate).
Bei den zahlreichen Kundgebungen
in verschiedenen Orten kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen
beiden Lagern und heftigen Angriffen auf die jeweils gegnerische Seite (siehe Seite Tumulte).
Zum Bild rechts:
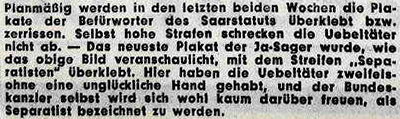
(Textausschnitt und Bild aus Saarbrücker Zeitung, Oktober 1955)
|

|
|
|
Die Heimatbundparteien stellten bei einem Sieg des "Nein" die Angliederung der Saar an die Bundesrepublik in Aussicht
|
|
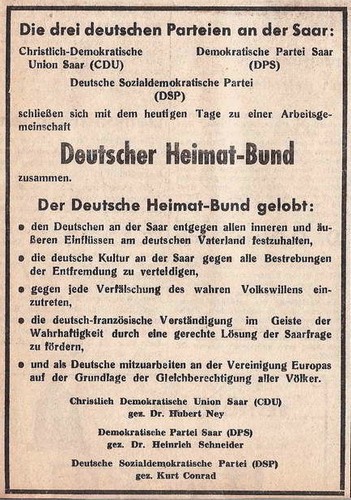
|
Am 3. September 1955 schlossen sich CDU-Saar, DPS und DSP zum Deutschen Heimat-Bund zusammen, um mit vereinten Kräften gegen die Annahme des Saarstatuts zu kämpfen (siehe links). [1]
Sie
bemühten sich, die Abstimmungsberech- tigten davon zu überzeugen, dass
ein Ja zum Statut nur "die Aufrechterhaltung des alten Zustandes mit
einem europäischen Etikett" [2] bedeuten und schließlich "die Saar
vollständig von Deutschland losreißen" [3] werde. Ein Nein könne
dagegen eine baldige Angliederung
an die Bundesrepublik ermöglichen - obwohl im Text des Statuts
keinerlei Aussagen über die Folgen einer Ablehnung zu finden waren.
Die Befürworter des Statuts bemühten sich, dieser Verfälschung der Frage auf dem Stimmzettel entgegenzutreten (siehe den Zeitungsausschnitt rechts).
Sie betonten immer wieder, die Regierung Hoffmann werde bei Ablehnung
des Statuts ihre
bisherige Arbeit und Politik im Saarland mit der Unterstützung der
Franzosen unverändert fortsetzen, nach dem Motto "Es bleibt alles beim
Alten!".
|
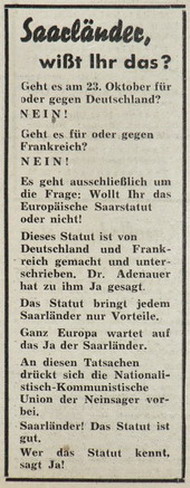
|
|
Auch der französische Außenminister Béliard nahm Stellung zu diesem Thema: Auf
Anfrage von Journalisten ließ er verlauten, gewisse saarländische
Parteien unterlägen einer Täuschung, wenn sie behaupteten, dass eine
Ablehnung des Statuts zu neuen Verhandlungen
zwischen dessen Unterzeichnern führen würde. Die Folge einer Ablehnung
könne für die Saar nur die automatische Rückkehr zu der Situation vor
dem 23. Oktober 1954 bedeuten [4]. Mit dieser strategischen Äußerung
mitten im Abstimmungskampf versuchte
der Minister vermutlich, den Ausgang des Referendums zu beeinflussen.
Wohl wegen des überraschend eindeutigen Abstimmungsergebnisses änderte
sich aber später die Haltung seiner Regierung in dieser Frage abrupt (siehe
unsere Seite Ergebnisse und Folgen unter c).
|
|
Heinrich
Schneider (D.P.S.) bemängelte, dass man den Wählern auf dem Stimmzettel
keine klare und eindeutige Frage stellte. Aus diesem Grund "werden wir
es tun", sagte er und erklärte den Saarländern, die Frage müsse
eigentlich lauten: "Wollt ihr euch von Deutschland trennen oder nicht?" [5]
Wie
der Stimmzettel bei der Volksbefragung aussehen würde, war den
Saarländern schon früh bekannt. Man hatte den genauen Wortlaut in
Zeitungen und auf Propaganda-Blättern bereits frühzeitig
veröffentlicht. Während
bei der Volksabstimmung vom 13. Januar 1935 die
Wähler
direkt darüber entscheiden sollten, ob die Saar an Frankreich oder ans
Deutsche Reich angeschlossen oder ob der Status Quo beibehalten werden
sollte, wurden bei der Volksbefragung 1955 die Abstimmungsberechtigten
lediglich gefragt, ob sie das Saarstatut billigten oder nicht. Sie konnten also nur "Ja" oder "Nein" ankreuzen.
|
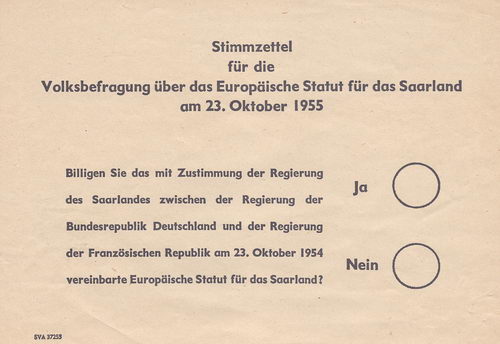
|
|
|
_____________________
[1] Mehr über den Heimatbund finden Sie in dem Zeitungsartikel "Deutscher Heimatbund" auf unserer Seite Zeitungen.
[2] Flugblatt des Deutschen Heimatbundes: "Wir sagen Nein zum Saarstatut". Siehe Seite Flugblätter, 8. Abbildung.
[3] Flugblatt der Jungen Union der CDU Saar: "Darüber schweigt Herr Hoffmann". Siehe Seite Flugblätter, 7. Abbildung.
[4] Presseerklärung vom 10.8.1955. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Europe (1944-1960), Sarre 276. Siehe Hudemann -
Heinen (Hrsg.). Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa 1945-1957. Saarbrücken 2007, Seite 521.
[5] "Deutsche Saar" Nr. 4 vom 10.8.1955; zitiert nach Johannes Hoffmann. Das Ziel war Europa. München und Wien 1963, S. 414.
|
|
Bitte lesen Sie zum Thema "Abstimmungskampf" auch die persönlichen Schilderungen auf der Seite Erinnerungen von Walter Lorang, und dort besonders im Abschnitt 4.
|
|
|
d) Zweigeteiltes
Land:
Der Abstimmungskampf
ging
mitten durch Familien, Freundeskreise, Vereine, Dörfer und
Gemeinden hindurch und trieb einen Keil zwischen die Saarländer.
Die "Verfeindung" innerhalb der Bevölkerung
ging so weit, dass sich beispielsweise Nein-Sager plötzlich weigerten,
weiterhin in Läden einzukaufen, die von Ja-Sagern geführt wurden - und
umgekehrt. Um Streitigkeiten von vornherein
aus dem Weg zu gehen, lud man zu Geburtstags- oder anderen Feiern
bestimmte Familienmitglieder nicht mehr ein, weil man von ihnen wusste,
dass sie politisch zur anderen Seite gehörten.
Ebenso wurden nun Lokale und Kneipen
gemieden, deren Besitzer auf der Gegnerseite standen. Die Feindschaften
hielten in einzelnen Familien und Freundeskreisen teilweise noch über
Jahrzehnte nach der Volksbefragung an.
Gerd
Schulthess aus St. Ingbert (1935 - 2013), dessen Mutter damals in der
CVP tätig war, berichtete über folgendes Erlebnis. Am 22. Oktober, dem
Vortag der Abstimmung, sollte im Karlsbergsaal seiner Heimatstadt eine
Großkundgebung mit den Vorsitzenden der drei Heimatbundparteien
beginnen, Heinrich Schneider (DPS), Hubert Ney (CDU-Saar) und Kurt
Conrad (DSP). Schulthess
saß mit zwei Freunden am
Rande der 4. oder 5. Reihe. Als der ebenfalls dort anwesende Hermann
Peter Barth von der CDU den ihm bekannten Statutsbefürworter erblickte,
forderte er ihn mit barschen Worten auf, ihm den Stuhl zu geben, auf
dem er saß: "Für Separatisten und Vaterlandsverräter
haben wir hier keinen Platz!" Was blieb dem damals kaum 20-Jährigen
anderes übrig, als seinen Stuhl zu räumen. Er hockte sich am Boden auf
seinen Mantel und hörte aufmerksam den Rednern zu.
Mit welcher
Inbrunst der Kampf von der ganzen Bevölkerung mitgetragen
wurde, und welche Auswirkungen er auf das Leben der Menschen
während dieser Zeit hatte, beschreibt der folgende
Ausschnitt aus Werner Reinerts Roman "Der Dicke
muss weg". [1]
|
|
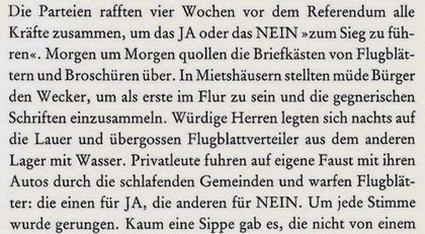
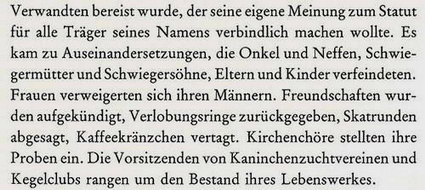
|
|
Armin Schlicker
schrieb auf der Internetseite des Historischen Vereins der Stadt Neunkirchen über den Abstimmungskampf:
"Die jahrelang
aufgestaute Wut über Annexionsversuche, Bevormundung,
Bespitzelung, Vorenthaltung demokratischer Rechte und
Abschottung von der Bundesrepublik brach jetzt explosionsartig
aus. Die Bevölkerung war auch deshalb so gegen
Hoffmann aufgebracht, weil dieser die Zustimmung der
Bundesregierung und des Bundestages zum Saarabkommen
so interpretierte, als ob damit alles, was vorher an
der Saar geschehen sei, eine Rechtfertigung gefunden
habe. Auf der prodeutschen Seite bestand die Sorge,
eine Annahme des Statuts könne die Trennung der
Saar von Deutschland auf unabsehbare Zeit zementieren.
(...)
Die Radikalisierung
des Abstimmungskampfes war das Ergebnis der 10-jährigen
Freiheitsunterdrückung an der Saar. Die neuen Möglichkeiten
der freien Meinungsäußerung in Wort und Schrift
wurden extensiv ausgenutzt. Dabei spielten der Vorsitzende
der DPS, Dr. Heinrich Schneider, und seine Zeitung Deutsche
Saar eine herausragende Rolle. Seine Veranstaltungen
waren am besten besucht, da er die härtesten verbalen
Attacken führte, die oft auch unter die Gürtellinie
gingen. Wahlveranstaltungen heute sind dagegen die reinsten
Kaffeekränzchen." [2]
|
|
Johannes Hoffmann beschrieb später (1963) die damalige Situation im Land so:
"Was
zurück blieb, war ein bis heute noch nicht ganz überbrückter Riß in der
Bevölkerung. Menschen, die sich dreizehn Wochen vorher noch Freunde
nannten oder gute Bekannte waren, obwohl sie ihre politischen Meinungen
kannten, hatten sich nicht nur zerstritten, sondern haßten und
verachteten sich. Wer "Ja" gesagt hatte, war verfemt und buchstäblich
als ehrlos gestempelt und wehrlos geworden. Im Inneren gab es kein
Fair-play." [3]
_________________
[1] Werner Reinert. Der Dicke muss weg. Dillingen, 1980, Seite 137f.
[2] Armin Schlicker auf der Internetseite des Historischen Vereins der Stadt Neunkirchen (www.hvsn.de)
[3] Johannes Hoffmann. Das Ziel war Europa. Der Weg der Saar 1945 - 1955. Wien, 1963, S. 426.
|
|
e) Der Konflikt zwischen Bundes-CDU und CDU-Saar
Eine
brisante Kontroverse ergab sich in diesem Abstimmungskampf aus der
Tatsache, dass die CDU-Saar als eine der Heimatbund-Parteien gegen, die Bundes-CDU aber für die Annahme des Statuts war, das deren Vorsitzender Konrad Adenauer mit Mendès France ausgehandelt hatte. Adenauer
sagte am
11.5.1955, er könne sich nicht vorstellen, warum das Saarland seine
Zustimmung zu einer Vereinbarung verweigern sollte, über die sich
Frankreich und Deutschland geeinigt hätten. In München soll Adenauer
geäußert haben: "Wer gegen das Pariser Abkommen ist, hat es entweder
gar nicht richtig gelesen - und das sind die meisten - oder er ist
nicht besonders beim Heiligen Geist gewesen, als
er auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, daß das Saarabkommen ein
gutes Abkommen ist." (Siehe: Johannes Hoffmann. Das Ziel war Europa. München und Wien 1963. S. 414.)
Auf Plakaten der Bundes-CDU rief Adenauers Konterfei den Saarländern zu: "Ja mit dem Bundeskanzler" (siehe Abbildung weiter oben, im Abschnitt c).
In einer Rede sagte er am 2. Sept. 1955 in Bochum, er verstehe sehr
gut, dass die Saarländer Johannes Hoffmann und seine Regierung endlich
loswerden 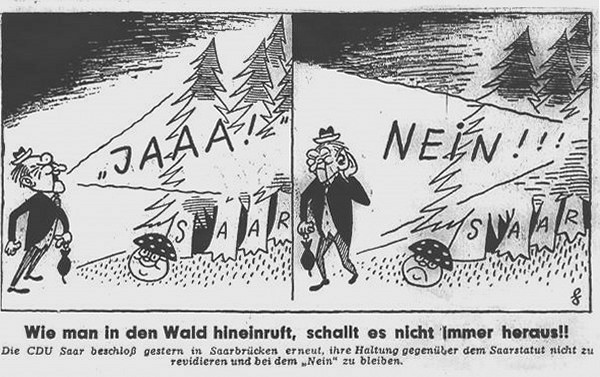 wollten, aber gerade deshalb sollten sie nun dem Statut zustimmen. Anschließend könnten sie einen
neuen Landtag wählen, mit dem dann eine neue Regierung
ohne JoHo gebildet werden könne. wollten, aber gerade deshalb sollten sie nun dem Statut zustimmen. Anschließend könnten sie einen
neuen Landtag wählen, mit dem dann eine neue Regierung
ohne JoHo gebildet werden könne.
Die Saar-CDU dagegen hatte
am 7. August 1955 in ihrer Gründungs- versammlung unter
Dr. Hubert Ney einstimmig beschlossen, gegen das Statut zu kämpfen. So kam es dazu, dass sich die
bundesdeutsche CDU und ihr Parteichef Dr. Adenauer von
der Haltung ihrer Schwesterpartei im Saarland distanzierten.
Lesen Sie dazu hier im 5. Bild einen Zeitungsartikel aus der AZ Mainz.
< Die Karikatur links haben wir der Abendpost
vom 19. 9. 1955 entnommen.
|
|
Was am Abstimmungstag und in der Zeit danach im Saarland geschah, lesen Sie bitte auf der Seite Ergebnisse und Folgen.
|
|
f) War es eine "Volksabstimmung"
oder eine "Volksbefragung"?
Wenn man über das Referendum von 1955 hört oder liest, findet man mal die eine, mal die andere Bezeichnung dafür. In
den meisten Abhandlungen über diesen Abschnitt der Saargeschichte wird
der Begriff "Volksbefragung" verwendet, in vielen anderen ist aber von
einer "Volksabstimmung" die Rede. Welche Bezeichnung ist die
"richtige", und gibt es Unterschiede zwischen den beiden?
Von
der Wortbedeutung her kann man ableiten: Wenn die Wahlberechtigten sich
für eine von zwei oder mehr Alternativen entscheiden sollen, lässt man
sie darüber abstimmen, wie z.B. bei der Volksabstimmung
von 1935 im Saargebiet: Beibehaltung des Status quo, Vereinigung mit
Frankreich oder Vereinigung mit Deutschland. Damit wurde festgelegt,
was bei der
Annahme der einzelnen
Punkte zu geschehen hatte.
In einer Volksbefragung sollen die Menschen dagegen auf eine bestimmte Frage mit Ja oder Nein antworten. Am
23. Oktober 1955 wurden die Saarländer gefragt, ob sie das Saarstatut
billigten oder nicht. Daher hatte die Regierung im Juli 1955 das
"Gesetz betreffend die Durchführung der
Volksbefragung" erlassen (siehe ganz oben unter a), und auf dem
offiziellen Stimmzettel hieß es: "Stimmzettel für die Volksbefragung
über das europäische Statut für das Saarland" (siehe Abbildung weiter oben).
Eine gewisse Verwirrung schafft allerdings die Tatsache, dass im Wortlaut der Verfassung des Saarlandes vom 15. Dezember 1947 eine Volksbefragung gar nicht vorgesehen war. Im Artikel 65 wird von "Wahlen und Volksabstimmungen"
gesprochen; im damals veröffentlichten französischen Text der
Saar-Verfassung heißt es dort "élections et référendums" [1]. In der
noch heute gültigen Verfassung des Saarlandes, die nach 1955 mehrfach
geändert wurde, ist immer nur von "Volksabstimmungen" und
"Volksentscheiden" die Rede.
Auch im Text des Abkommens vom 23. Oktober 1954 über
das Statut der Saar tritt der Begriff "Volksbefragung" nirgends auf. Im
Artikel I ist festgelegt: "Nachdem das Statut im Wege einer Volksabstimmung
gebilligt worden ist, kann es bis zum Abschluss eines Friedensvertrages
nicht mehr in Frage gestellt werden". Auch im weiteren Textverlauf ist
immer nur von einer "Volksabstimmung" die Rede. Aber in der
Einleitung zu der "Bekanntmachung betreffend das Abkommen" im Amtsblatt
des Saarlandes Nr. 87 vom 23. Juli 1955 heißt es, dass das Statut
"Gegenstand der Volksbefragung im Saarland sein wird".
Dr. Heinrich Schneider,
Parteivorsitzender der DPS, stellte schon im November 1954 fest: "Die
häufig gebrauchte Bezeichnung "Volksabstimmung" ist irreführend und
falsch. Es handelt sich bei der Fragestellung an die Saarländer, das
Statut zu bejahen oder abzulehnen, nur um eine Volksbefragung, also um ein Referendum.
Im Gegensatz zu der echten Volksabstimmung vom 13. Januar 1935 muß
dieser sprachliche Unterschied deutlich hervorgehoben werden." [2]
Wie werden "Referenden" in anderen deutschsprachigen Verfassungen bezeichnet? Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland werden nur die Begriffe Volksbegehren und Volksbefragung verwendet; der Ausdruck Volksabstimmung kommt hier nicht vor. Ein Volksentscheid ist für den Fall der Neugliederung des Bundesgebiets vorgesehen, also bei der "Bildung eines neuen oder neu umgrenzten Landes" (Artikel 29) sowie zum Zweck der "Verfassungsablösung" (Artikel 146). - In den Verfassungen der einzelnen Bundesländer
findet man nur die Begriffe "Volksbegehren" und "Volksentscheid". - Gemäß der Verfassung Oesterreichs ist eine Volksbefragung dort ein unverbindliches Referendum. Sie ist konsultativ, d.h., das Parlament ist nicht an ihr Ergebnis gebunden (es hat allerdings dort bisher erst eine einzige Volksbefragung stattgefunden, nämlich 2013 zum Thema "Berufsheer oder Wehrpflicht?"). Im Gegensatz dazu ist das Ergebnis einer Volksabstimmung in Oesterreich für den Staat bindend.
Fazit: Obgleich
sowohl die Saar-Verfassung als auch das Saarstatut selbst nur das Wort
"Volksabstimmung" verwendeten, war das Referendum am 23. Oktober 1955
vom Wesen her eine Volksbefragung; und es wurde damals von offizieller
Seite auch so genannt.
________________
[1] Siehe ABl. d. Saarlandes Nr. 67 - 1947, S. 1085; den vollständigen Text der Verfassung von 1947 finden Sie auch hier auf Saar-Nostalgie.
[2] Dr. Heinrich Schneider. Die Saar deutsch oder europäisch? Comel-Verlag Köln, 1954. Anm. auf S. 13.
|
Über das Ergebnis und die Folgen der Volksbefragung lesen Sie bitte >auf dieser Seite.
|
(Stimmkarte: Sammlung Daniel Götz)
Auf den Seiten:
Aufkleber und Zettel * Flugblätter *
Karikaturen * Plakate * Verse * Zeitungen und Zeitungsartikel * Tumulte bei Kundgebungen
sehen Sie umfangreiches Propagandamaterial aus dem Abstimmungskampf von
1955, Plakate, Handzettel, Flugblätter, Aufkleber
usw., von denen
der Autor dieser Website damals - er war gerade 13 Jahre alt - zahlreiche
Exemplare in den Straßen seiner Heimatstadt
Neunkirchen aufgesammelt oder von Wänden und Laternenpfosten
abgezogen hatte. Zusammen mit Zeitungsausschnitten hat er sie damals in drei alte Schulhefte
eingeklebt (s.
Foto unten) und jahrzehntelang
aufbewahrt, bis er sich 2007, anlässlich der 50-Jahrfeier
des Bundeslandes Saar, dazu entschloss, die interessantesten
davon ins Internet zu stellen. Daher sind die meisten
der auf den folgenden Seiten gezeigten Dokumente aus
seiner Sammlung
(Ausnahmen -
hauptsächlich Plakate - sind durch Quellenangaben
gesondert gekennzeichnet). Einige Stücke stammen
auch aus der Sammlung von Wilhelm Mäs, Riegelsberg,
die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt
hat.
Die Dokumente sind absichtlich
nicht nach "Ja- und Nein-Parteien" getrennt, sondern nach Themen sortiert.
|
Auf unserer Seite Das Saarstatut finden Sie ausführliche Informationen über die Entstehung des Statuts, seine Bedeutung für das Saarland und seinen vollständigen Wortlaut.
Auf der Seite Ergebnisse und Folgen können Sie nachlesen, wie die weitere politische Entwicklung im Saarland nach der Volksab- stimmung verlief.
________________________
Literaturangaben zum Thema Saarstatut und Volksbefragung
Benutzte Literatur
- Altmeyer, Klaus. Saarstatut und Volksbefragung 1954/55. In:
DAMALS. Zeitschrift für geschichtliches Wissen. Gießen/Lahn. Heft 10
Oktober 1980, S. 831 - 850
- Ames, Gerhard, Linsmayer, Ludwig (Hg.). Ja und Nein - Das Saarreferendum von 1955. Saarbrücken, 2005
- Elzer, Herbert. Die deutsche Wiedervereinigung an der Saar. Bd. 8 Schriftenreihe d. Stiftung Demokratie Saarland. St. Ingbert, 2007
- Heinen, Armin. Saarjahre. Politik und Wirtschaft im Saarland 1945-1955. (HMRG, Beiheft 19.) Stuttgart, 1996
- Hoffmann, Johannes. Das Ziel war Europa. Der Weg der Saar 1945-55. Wien, 1963
- Hüser, Judith. "Dieser Weihnachtsmann eines Saarstatuts". Frankreichs Politik im Abstimmungskampf 1955. In: Von der 'Stunde 0' zum 'Tag X'. Das Saarland
1945-1959. Saarbrücken, 1990
- Reinert, Werner. Der Dicke muss weg. Ein Saar-Roman, Dillingen/Saar, 1980
- Schmidt, Robert H. Saar-Politik 1945 - 1962. Berlin, 1959 - 1962 (3 Bände)
- Schneider, Heinrich. Das Wunder an der Saar. Ein Erfolg politischer Gemeinsamkeit. Stuttgart, 1974
Weiterführende Literatur
- Altmeyer, Klaus u.a.. Das Saarland. Saarbrücken, 1958
- Freymond, Jacques. Die Saar 1945 - 1955. München, 1961
- Herrmann, Hans Walter. Sante, Georg Wilhelm. Geschichte des Saarlandes.
- Hudemann, Rainer & Poidevin, Raymond (Hrsg.). Die Saar 1945-1955. Ein Problem der europäischen Geschichte. München 1992
- Hudemann, Rainer u. a. (Hrsg.). Grenz-Fall. Das Saarland zwischen Frankreich und Deutschland 1945-1960
(Schriftenreihe
Geschichte, Politik
& Gesellschaft der Stiftung Demokratie Saarland, Band 1). St.
Ingbert, 1997
- Hudemann, Rainer, Heinen, Armin (Hrsg.). Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa 1945-1957. Ein Quellen- und Arbeitsbuch. Saarbrücken 2007
- Schäfer, Johannes. Das autonome Saarland: Demokratie im Saarstaat 1945-1957. St. Ingbert, 2012
- Stadtverband Saarbrücken, Regionalgeschichtliches Museum (Herausg.) Von der 'Stunde Null' zum 'Tag X', Saarbrücken, 1990
|
|
 Voici une grande partie du texte de ce chapitre en langue française:
Voici une grande partie du texte de ce chapitre en langue française:
L'accord entre le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et la République Française sur le statut de la
Sarre ("Saarstatut") fut signé par le Chancelier allemand Adenauer et
le Premier Ministre français Pierre Mendès France le 23 Octobre 1954. Cet
accord prévoyait essentiellement une européanisation du pays de la Sarre qui,
tout en gardant l'union économique avec la France, devenait un territoire
supranational et accueillait différentes administrations
européennes. La Sarre pouvait ainsi remplir la fonction d'un élément
constitutif d'une communauté future d'Etats européens.
a)
Le 8 juillet 1955, la loi concernant
l'organisation de la consultation populaire entra en vigueur. Cette loi
réglementait tous les détails du Reférendum et reposait sur le principe
qu'il devait être général, uniforme, secret et libre.
La campagne électorale était également réglementée,
par exemple en ce qui concernait la presse, les tracts, les inscriptions et les
affiches (§§ 27 à 29). Les haut-parleurs sur les places publiques et dans les
rues étaient interdits (§ 30), les réunions publiques politiques en plein air
l'étaient aussi (§ 32), elles devaient se tenir dans des locaux ou des salles
appropriés. La radio et la télévision ne devaient donner un temps d'antenne à
aucun parti politique. Leurs informations sur le déroulement de la campagne
électorale devaient respecter le principe de neutralité (§ 31).
b) Trois mois avant le jour du scrutin, les partis politiques
ainsi que les
associations, les journaux et les réunions publiques furent libérés de
l'obligation de solliciter une autorisation préalable, conformément au
statut de
la Sarre (§VI et X). Ainsi des partis interdits (DPS) ou non admis
jusque-là (CDU-Saar) purent, sans censure, se montrer en public. Du
fait de cette période très courte jusqu'au reférendum, les nouveaux
partis durent en toute hâte
trouver les moyens pour financer leurs activités et créer des organes
de presse
appropriés.
Pour
l'utilisation des panneaux d'affichage, les organisations européennes
de l'époque furent considérées comme des partis politiques.
c) La vraie campagne électorale du référendum
commença officiellement le 23 juillet 1955. Elle fut contrôlée, ainsi que le
vote lui-même, par une commission de l'U.E.O (Commission européenne pour le
référendum en Sarre).
Tous les chefs de partis, tous les directeurs
de journaux et les éditeurs d'autres publications, tous les orateurs dans les
réunions publiques devaient obligatoirement être autorisés à participer au
reférendum, donc avoir le droit de vote. Tous les tracts et toutes les
affiches devaient être imprimés en Sarre et devaient comporter la mention de
l'éditeur et de l'imprimeur. On pensait par ces mesures éviter l'influence
d'une propagande électorale de l'étranger sur la campagne du référendum,
surtout de la part de la République Fédérale d'Allemagne. Malgré tout, une
grande quantité de matériel de propagnade passa clandestinement la frontière
entre la Sarre et l'Allemagne et fut distribuée à la population.
Cette
campagne électorale se déroula dans un
climat passionné entre ceux qui acceptaient le statut de la Sarre et
ceux qui le refusaient. Elle se fit à l'aide d'affiches (> Plakate), de tracts (> Flugblätter) et d'autocollants (>Aufkleber) de toutes sortes, mais aussi par des annonces dans la presse et des manifestations
publiques. Les partis, n'ayant pas peur de recourir aux insultes et aux
injures, se livrèrent dans les journaux et les tracts à des coups bas, ignobles
et sordides.
Les deux camps firent campagne en usant
d'insultes faciles et primaires: les uns traitèrent les partisans du statut de
séparatistes, les autres traitèrent les opposants au statut de nationalistes,
ou même de nazis. Ils se permirent ainsi des outrages et des dérapages sans
aucune limite, allant jusqu'à abîmer les affiches et les autocollants de leur
adversaire en les recouvrant de peinture, en les déchirant ou en les recouvrant
d'un autre texte. Les réunions publiques des deux camps donnèrent lieu à de
graves conflits entre, d'un côté, les opposants au statut et de l'autre le
Premier Ministre Hoffmann et son gouvernement (voir le chapitre Tumultes).
d) Un pays divisé
Le combat divisa
les familles, les cercles d’amis, les associations, les villages, les communes
et sema la zizanie entre les gens.
L’animosité au
cœur de la population avait atteint un tel point que les opposants au statut ne
fréquentaient plus les magasins des adeptes de celui-ci et vice versa. De la
même façon on a fui tout à coup les restaurants et les bistrots des
propriétaires politiquement opposés. Pour éviter des discussions dès le début,
certains membres de la famille ne furent plus invités, pour la seule raison
qu’ils étaient connus comme appartenant au groupe adverse.
Armin Schlicker écrit sur www.hvsn.de (traduction):
"La
colère accumulée à la suite des tentatives d'annexion, de
lasurveillance, de la privation des droits démocratiques et de la
séparation
d'avec la République Fédérale d'Allemagne apparut au grand jour et
explosa. La
population était remontée contre le gouvernement Hoffmann, entre autres
parce
que celui-ci avait pris l'approbation du statut de la Sarre par le
gouvernement
et le Parlement de la République Fédérale pour une justification de
tout ce qui
s'était passé auparavant en Sarre. Du côté pro-allemand, on craignait
qu'une acceptation du statut cimenterait la
séparation de la Sarre d'avec l'Allemagne pour un temps incalculable."
"La
radicalisation de la campagne électorale fut le résultat du manque
deliberté que subissait la Sarre depuis dix ans. On abusa, par écrit ou
oralement, de la toute nouvelle liberté d'opinion. Le Président du DPS,
Monsieur Heinrich Schneider, et son journal "Deutsche Saar" jouèrent là
un rôle primordial. Ses réunions étaient très fréquentées parce que les
attaques dans ses discours étaient des plus dures et manquaient souvent
de
fair-play. Les réunions électorales actuelles sont en comparaison des
réunions
de commères."
Deux jours avant
le référendum, le Ministre de l’Intérieur , Edgar Hector, défendit par
ordonnance aux restaurants et aux bars la vente de boissons alcoolisées le dimanche
de la consultation populaire à partir de minuit jusqu’à lundi matin, 7 h. Il
fut uniquement permis de débiter de la bière et du vin au moment des repas. Cela pour éviter
que la consommation d’alcool provoque une surchauffe de la tension déjà
existante.
Le conflit entre l'Union Chrétienne-démocrate fédérale
et l'Union Chrétienne-démocrate sarroise créa une situation explosive.
Le Chancelier Konrad Adenauer, qui avait élaboré le statut de
la Sarre avec Pierre Mendès-France, était, comme son parti
l'Union Chrétienne-démocrate fédérale, évidemment partisan de l'adoption du
statut. Il demanda donc aux citoyens sarrois d'approuver le statut. Sa photo
sur les affiches "Oui au statut" les y poussait (voir plus haut).
Dans son discours du 2 septembre à Bochum, il leur expliqua qu'il comprenait
bien leur désir de se débarrasser de Johannes Hoffmann et de son gouvernement, mais
que c'était, au contraire, en approuvant le statut qu'ils y arriveraient. Ils
pourraient ensuite élire un nouveau parlement et former un nouveau
gouvernement.
L'Union chrétienne-démocrate sarroise avait,
au contraire, dans sa réunion fondatrice du 7 août 1955, sous la direction du
Dr Hubert Ney, décidé à l'unanimité de lutter contre le statut.
Ainsi l'Union Chrétienne-démocrate fédérale et son chef, le Dr Adenauer, furent
amenés à se démarquer de leur parti frère en Sarre.
(Traduction par Rita Bruchier) |
Diese Seite wurde 2007 begonnen und zuletzt bearbeitet am 2.3.2020
|
nach oben

|
 zurück
<------------> weiter zurück
<------------> weiter

wwwonline-casino.de
(Gesamt seit 2008)
Home (zur Startseite) > www.saar-nostalgie.de
|