MAHLZEIT
Erinnerungen an Fritz und Gerti Weissenbach von Gerhard Bungert
(Alle Fotos in diesem Text: Landesarchiv Saarbrücken, Sammlung Weissenbach)
Mit "MAHLZEIT!" endeten die Sendungen mit Fritz und Gerti Weissenbach. Man spürte
schon vorher: Jetzt muss es kommen. Meistens gingen ein paar Zeilen Gereimtes
voran, nach dem Muster:
|
Fritz:
Gerti:
Fritz:
Gerti:
Fritz:
Beide:
|
Manch ähner, das is gewiss,
verreißt sich
heitsedaachs die Schniss
unn rätscht unn schellt die ganze
Zeit
am liebschde iwwer
Nachbarsleit.
Doch eischne Feehler sinn tabu
fier so e Ochs
unn fier e Kuh.
M a h l z e i t !
|

|
|
Es
war wie die Schlussszene in einem alten Liebesfilm. Da ahnte man auch
immer das Ende. Die Kamera zoomte auf die Lippen, die Musik
wurde lauter, und auf der Leinwand erschien das Wort „Ende“. Bei Fritz
und Gerti Weissenbach ging es
allerdings nicht um Liebesschwüre und Heiratsabsichten, sondern um
Alltägliches, Typisches und Witziges.
Mit dem saarländischen Mittagsgruß MAHLZEIT fanden die Dialoge ihr sprachliches
Finale. Gegen 12 Uhr hallte MAHLZEIT
durch die Flure der Büros, die zur Kantine führten. Gleichzeitig klang MAHLZEIT
aus dem Radio in Küchen und Werkstätten - von Perl bis Peppenkum, vom Warndt
bis nach Wadern. Aber auch darüber hinaus:
in den Hochwald und in die Westpfalz, nach Luxemburg und Lothringen.
|
Vor dem Wort MAHLZEIT standen aber auch immer
unausgesprochen die beiden Wörter „Na dann“. Das war gewollt. Der kulinarische
Mittagsgruß bekam so seine zweite Bedeutung: ein sprachliches Abwinken.
Die Weissenbachs waren, wie ihr Kollege Ferdi Welter,
überzeugte Sozialdemokraten. Gerti Weissenbach unterstützte zum Beispiel in einer
Wählerinitiative den späteren Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine. Die
beruflichen Anfänge der Weissenbachs führen aber zurück in die
Saarland-Kultsendungen der Nationalsozialisten. Die waren vordergründig unpolitisch.
Auch mit Mundart und volkstümlichem Humor versuchten die Nazis, die
„Saarfranzosen“ für Volk und Vaterland, letztlich für Krieg und Völkermord zu
gewinnen. Der Mundart-Slogan der Nazis, das „Nix wie hemm“ der Saarabstimmung
1935, hatte eindeutig in die falsche Richtung gewiesen.
Bis dass der Tod uns scheidet
Populär
wurden die Weissenbachs in der Vorfernsehzeit. Man hörte Radio Saarbrücken. Die
andern Programme rauschten, und der Hal(l)berg machte noch nicht so viele
Wellen. Die Zuhörer mussten und konnten sich selbst ihr Bild machen. Ihre
Phantasie war gefragt. Sie konnten noch zuhören, und das machten sie gerne,
zumal die Weissenbachs sich ihrer eigenen Sprache bedienten.
Im
teilautonomen Saarstaat standen die
Mundartsendungen allerdings in einem anderen Kontext als im Dritten
Reich. Die
saarländische Mundart war fast so etwas wie die zweite Nationalsprache,
ähnlich
dem Sächsischen in der ehemaligen DDR. Saarländisch erzeugte auch
politisches
Selbstbewusstsein in einer von Fremdbestimmung
geprägten Geschichte. „Mir wisse, was gudd is“ war mehr als ein
Werbeslogan für Fauser-Margarine. Der Satz konkretisierte sich in der
Feststellung: „Mir schwätze, wie uns de Schnawwel gewachs is“. Die
Präsenz der Mundart im Rundfunkprogramm lieferte die Unterstützung von
oben.
Abschaffen der Weissenbachs nach demTag X? - Unmöglich! - Eher hätte man
die Saarschleife begradigen können. Selbst der Umbau des Programms in den
sechziger Jahren - nach dem Muster von Radio Luxemburg - konnte den
Weissenbachs nichts anhaben. Auf die Frage, wie lange noch die Weissenbachs mit
dem Saarländischen Rundfunk verbunden bleiben, antwortete mir Fritz Weissenbach
noch 1977 mit der Hochzeitsfloskel:
„Bis dass der Tod uns scheidet.“ Er
sollte Recht behalten.
Die ersten Erinnerungen
|
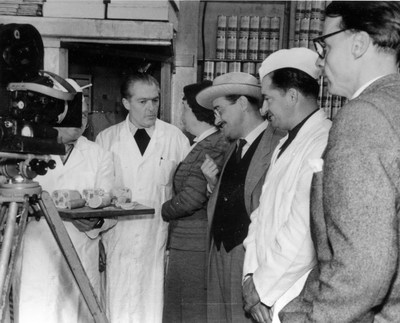
|
Mitte
der fünfziger Jahre - ich war noch nicht in der Schule – da habe ich
die Weissenbachs zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Wo
fünf Jahre später der Fernseher stand, da thronte noch das Radio - in
etwa gleicher Größe. Da stellte man auch
schon mal Stühle davor, um sich in aller Ruhe Sendungen anzuhören.
Meistens
waren die Beiträge in Hochdeutsch, aber es gab auch Mundartsendungen.
Ernst
waren sie selten. Kuriose Mitmenschen und typische Situationen wurden
aufs Korn genommen. Die Mundartsprecher hielten uns den Spiegel vor.
In der ersten Sendung der Weissenbachs, die ich bewusst hörte, ging es wirklich um eine
Mahlzeit, konkret: um Linsensuppe.
Gerti sagte: „Das Leben ist am schwersten, drei Tage vor dem Ersten.“ Dann
begann ein volkstümlich-philosophischer Disput
über das liebe Geld. Er mündete in dem Vorschlag von Fritz: „Ei wenn es Geld net ausreicht, dann kommt
äwe mol kenn "Werschdsche in die Linsesupp."
|
|
Diese
Aussage verstand ich nicht. Der Grund war einfach. Bei uns kam niemals
ein Würstchen in die Linsensuppe. Die wurde mit ausgelassenem Speck
„geschmelzt“. Haarscharf
analysierte ich damals: Wir sind arme Leute.
Das Foto zeigt Fritz Weissenbach (3. von rechts) in einer Fernsehproduktion von TELESAAR.
|
Lehrjahre bei den Weissenbachs
21
Jahre später saß ich im Hörfunkgebäude des Saarländischen Rundfunks vor
dem Schreibtisch des
Unterhaltungsredakteurs Emil Schäfer. Er fragte mich, ob ich nicht Lust
hätte, regelmäßig Beiträge für Fritz
und Gerti Weissenbach zu schreiben. Zweimal die Woche, für den Dienstag
und den
Donnerstag ab 11 Uhr 45. Die Länge leitete sich ab von der damaligen
Dauer
aller Beiträge: 3 Minuten und 30 Sekunden. Die Sendung „Allerhand für
Stadt und
Land“ gab es ja nicht mehr. Sie wurde von der „Spielbox“ abgelöst, und
die moderierten Ilona Kleitz
(die spätere Ilona Christen) und Manfred Sexauer. Für die beiden würde
ich ja auch schreiben, betonte Emil Schäfer,
und er erklärte mir: Einmal in der Woche wäre die Vorproduktion. Aber
darum brauchte ich mich nicht zu kümmern. Die Regie mache er selbst.
Als Berufsanfänger ließ ich mich vom
Honorar überreden. Ich wollte aber auch von den Weissenbachs lernen. Fast jede
Woche aß ich einmal mit ihnen in der Kantine des Saarländischen Rundfunks. Wir diskutierten, (v)erzählten und lachten
viel. Vor allem drei Dinge habe ich von ihnen gelernt:
 1.
Mit äußerster Konzentration und großer Ernsthaftigkeit bereiteten sie
sich vor. Jede Betonung und jede Pause waren überlegt. Sie
übertrieben nicht und blieben immer natürlich. Vor allem bei Gags und
Witzen
muss das Timing stimmen. Ein falsches Wort, eine falsche Betonung oder
eine zu
kurze Pause - und alles ist futsch. Zwei Profis mit Bodenhaftung. Sie
spielten
nicht die Weissenbachs, sie waren die Weissenbachs. Man spürte ganz
einfach die
jahrzehntelange Erfahrung mit einer täglichen, aber nicht alltäglichen
Sendung. Kein Zufall, dass sie so gut und populär
waren. 1.
Mit äußerster Konzentration und großer Ernsthaftigkeit bereiteten sie
sich vor. Jede Betonung und jede Pause waren überlegt. Sie
übertrieben nicht und blieben immer natürlich. Vor allem bei Gags und
Witzen
muss das Timing stimmen. Ein falsches Wort, eine falsche Betonung oder
eine zu
kurze Pause - und alles ist futsch. Zwei Profis mit Bodenhaftung. Sie
spielten
nicht die Weissenbachs, sie waren die Weissenbachs. Man spürte ganz
einfach die
jahrzehntelange Erfahrung mit einer täglichen, aber nicht alltäglichen
Sendung. Kein Zufall, dass sie so gut und populär
waren.
2. 1976 schrieb ich mit Klaus-Michael Mallmann das Theaterstück „Eckstein ist
Trumpf - ein Volksstück über die Anfänge der Bergarbeiterbewegung an der
Saar“. Das Saarländische Landestheater
führte es auf, es kam gut an. Aber in der Saarbrücker Zeitung wurde es von der
Kritik verrissen. Die Weissenbachs sagten mir, das sei gar nicht so schlecht.
Schlimm sei es nur, wenn sie überhaupt nicht berichten. Der Verriss zeige, dass man uns ernst nehme.
Recht hatten sie. Zwei Jahre später erhielten Klaus Michael Mallmann und ich
für die Hörspielfassung des Stücks den Kurt-Magnus-Preis der ARD.
3. Von
den Weissenbachs lernte ich das, was ich als „volkstümliche Lautschrift“
bezeichne. Es mag für einen nicht-saarländischen Germanisten sinnvoll sein, in
einem saarländischen Mundarttext das Wort „Schdinga“ zu lesen. Ich aber
schreibe - wie im Hochdeutschen -– „Stinker“. Da weiß man sofort, was gemeint
ist. Außerdem brauchten wir damals eine Art „saarländische Hochsprache“, ein
„Oxford-Saarländisch“, das im moselfränkischen Raum ebenso verstanden wurde wie
im rheinfränkischen. Und das musste lesbar sein. Fritz Weissenbach drückte das
so aus: „Im Zweifelsfall immer so schreiwe wie im Hochdeitsche. Dann kenne mir
das aach lese.“
Ein Sketch entsteht
In
meinem Büro in Südfrankreich habe ich mehrere hundert Mahlzeit-Sketches
archiviert. Daneben stehen fünf Karteikästen: meine
Gag-Kartei. Sie enthält Witze, Zitate, Sprachspiele und Kurzinfos zu
allenmöglichen Themenbereichen. Diese haben wiederum eine klare
Binnenstruktur.  Da
gibt es etwa die Abteilung „Lebensabschnitte“ (von der Zeugung bis zu
Petrus imHimmel) oder „Das Jahr im Wandel“ (von Neujahr bis Silvester).
Ständig füllte ich sie auf
mit eigenen Einfällen, mit Dingen, die ich irgendwo aufschnappte, aber
auch mit Fundsachen aus Zeitungen und Illustrierten. Da
gibt es etwa die Abteilung „Lebensabschnitte“ (von der Zeugung bis zu
Petrus imHimmel) oder „Das Jahr im Wandel“ (von Neujahr bis Silvester).
Ständig füllte ich sie auf
mit eigenen Einfällen, mit Dingen, die ich irgendwo aufschnappte, aber
auch mit Fundsachen aus Zeitungen und Illustrierten.
Wenn etwa der Frühlingsanfang bevorstand, dann holte ich aus dem Kasten „Das Jahr im Wandel“
die entsprechenden Karteikarten heraus. Vieles konnte ich nicht gebrauchen,
aber dann stieß ich zum Beispiel auf eine Karte, da stand „Der Frühling ist
ausgebrochen – der Gefängnisinsasse auch“. Da Fritz und Gerti Weissenbach genau
gegenüber dem Lerchesflur-Gefängnis in Saarbrücken wohnten, würde ihnen das
sicher gut gefallen. Ich schrieb dann einen Dialog zum Thema Frühlingsanfang,
bei dem zunächst beide aneinander vorbei redeten.
Fritz: (pathetisch, hochdeutsch) Der Frühling ist
ausgebrochen (dann alltäglich, schnell, saarländisch) heit morje um Vertel vor 6.
Gerti (entsetzt, redet ohne Punkt und Komma, Fritz versucht vergebens, sie zu unterbrechen):
Oh Gott, jetzt aach das noch! - Ma is jo
heitsedaachs nemmeh sicher. Es is jo aach kenn Wunner. Das kommt alles nur von denne Reforme. Ich
sahns jo... usw.
Im gleichen Sketch rezitiert Fritz den
mittelalterlichen Minnesänger Walther von der Vogelweide. Der habe ein
Frühlingsgedicht geschrieben. Das fange an mit: „Ich saß auf einem Stään“.
Gerti verstand nicht, doch Fritz erklärte ihr das: „On
änem Stään sitze, das kann ma jo nur in rer warm Jahreszeit mache, sonschd kriehd ma Huddel mit de Niere.“
Dann will sie wissen, wie der Dichter hieß, und Fritz sagt korrekt: „Walther von der Vogelweide“. Gerti lacht und behauptet,
das sei bestimmt ein Künstlername. In Wirklichkeit habe der gesessen, obwohl er
gestanden habe: „Das war de Walder von der Lerchesflur“.
Unterhaltung ist Training
Neben den Mahlzeit-Sketches schrieb ich ein bis zwei
Dutzend Mundarthörspiele, in denen Fritz und Gerti Weissenbach die Hauptrolle
spielten. Als Autor der Mahlzeit-Sketches blieb ich anonym, wie die andern
auch. Bei den Hörspielen stand selbstverständlich mein Name in der
Programmvorschau und wurde auch vor oder nach der Ausstrahlung genannt. Meine
eher intellektuellen Freunde schüttelten darüber den Kopf. Denn gleichzeitig
beschäftigte ich mich journalistisch und literarisch mit ernsthaften Themen.
Das ging für sie nicht zusammen. Das war unseriös, denn Mundart war in den
siebziger Jahren noch vor allem die Sprache der Straße und der Fastnacht. Gegen beides hatte ich
nichts.
Für mich war das auch ein hervorragendes Training. In
den saarländischen Themen und in der Mundart war ich zu Hause, und es schadet
ja nichts, wenn man in einer Sprache, die man beherrscht, über Dinge schreibt,
die man kennt. Unterhaltung hat noch einen zusätzlichen Vorteil: Man bekommt
sofort eine Rückkoppelung. Der kleinste Fehler rächt sich. Man lernt. Nehmen
wir mal einen alten saarländischen Dialog:
Zwei pensionierte Bergleute sitzen vor der Kaffeeküche
auf einer Bank. Da kommt die hübsche Tochter des Pächters vorbei. Der Hennes
schaut sie an und singt: „Man müßte nochmal zwanzig sein“. Darauf sagt der Jäb:
„Ich wääß net, wege denne fünf Minute wedder verzig Johr unner Daach…“
Mit wenigen Mitteln kann man diesen Witz kaputt
machen. Die konkreten Angaben (Kaffeeküche, Bank, Tochter des Pächters, die
Namen der zwei) sind notwendig, um das Milieu zu charakterisieren. Eine
unnötige Information (um 14 Uhr, grüne Bank usw.) führt unweigerlich in die
Irre. Die indirekte Rede würde alles kaputt machen, auch das Erzählen von
hinten. Niemand würde auch nur schmunzeln, geschweige lachen. So schreiben und
erzählen wir allerdings keine Witze. Weil wir das ja selbst merken. Aber bei
„normalen“ Sachtexten und bei offiziellen Reden ist das anders. Da kriegen die
Produzenten von Langeweile oft nicht mit, was sie anstellen. Sie haben dadurch auch keine Chance, etwas für die Zukunft
zu lernen.
Weissenbachs Erben
Unterhaltung verhält sich zur Literatur wie Gymnastik
zum Sport. Sie lockert auf und stimmt ein. Für alle, die damit umgehen können,
bietet sie viele literarische Möglichkeiten. Wer
die Nase über das Werk von Loriot rümpft, hat nicht nur keine Ahnung, sondern
ist auch ein unangenehmer Zeitgenosse. Wie wichtig auch Mundart ist, um
literarische Figuren vollblutig werden zu lassen, das sieht man selbst in der
Weltliteratur, etwa in „Professor Unrat“ von Heinrich Mann. Das sah man im
Saarland der siebziger Jahre allerdings noch anders. Doch bald sollte sich das
ändern - durch saarländische Kabarettisten wie Gerd Dudenhöffer und Schorsch
Seitz sowie durch Schriftsteller wie Ludwig Harig und Alfred Gulden. Mediale
Zustimmung gab es 1980 durch die Saarlandwelle, politische 1985 durch Oskar
Lafontaine. Ich selbst werkelte in der „Schnittmenge“ von allen.
Nach dem Tod von Fritz Weissenbach gehörte Gerti
Weissenbach noch zur Starbesetzung des Hörfunk-Comics „Lyoner 1 antwortet
nicht“ (1982). Gerd Dudenhöffer und
Peter Maronde waren mit dabei, und Manfred Sexauer führte Regie. Geschrieben
hatte ich die 24 Folgen gemeinsam mit dem saarländischen Mundart-Kabarettisten
Schorsch Seitz. Gerti Weissenbach trug entscheidend dazu bei, dass niemand über
die Science-fiction-Parodie sagen konnte:
Na
dann MAHLZEIT!
Ihr
Gerhard Bungert
Ein weiteres Foto von Fritz Weissenbach (mit seinem Renault 4 CV) finden Sie hier auf der Seite Crèmeschnittchen.
Mehr über Radio Saarbrücken sowie Rundfunk und Fernsehen im Saarland allgemein gibt es in unserem Kapitel RADIO und FERNSEHEN.
|