|
oben
|
Home (zur Startseite) >> www.saar-nostalgie.de
|
|
Trolleybusse (Obusse)
mit
Texten von Karl
Presser
|
Inhalt
dieser Seite:
|
1) Saarbrücken
2) Völklingen
3) Neunkirchen
|
>
Übersichts-Seite VERKEHR - PKW
- Straßenbahn -
Kraftpost-Omnibusse - Andere Omnibusse -
LKW
und andere
Nutzfahrzeuge
|
|
Einführung
Nach dem
Zweiten Weltkrieg war der öffentliche
Personennahverkehr ein vordringliches Thema, hing
doch der Wiederaufbau der Länder wesentlich davon ab,
dass die Arbeitsplätze gut und schnell erreichbar
waren.
In der
Vorkriegs- und Kriegszeit fuhren im Saarland
Straßenbahnen und Omnibusse. In der
Nachkriegszeit erschien eine Kombination von
Straßenfahrzeug und leitungsgebundenem
Elektroantrieb, wie sie der Oberleitungsbus
(kurz Obus) anbot, attraktiv, weil Bau und
Erhaltung eines gesonderten Fahrwegs (wie die
Schienen bei den Straßenbahnen) entfallen konnten.
Dadurch waren diese Fahrzeuge nicht an eine feste
Fahrspur, sondern nur an den Verlauf der Oberleitung
gebunden. Nicht jedes falsch geparkte Fahrzeug auf
dem Fahrweg eines Obusses brachte diesen - wie die
Straßenbahn
- zum Stillstand. Er konnte innerhalb seiner durch
die Oberleitung vorgegebenen Fahrspur um etwa vier
Meter nach beiden Seiten pendeln.
Auch die Tatsache, dass Obusse im
Kriegsfall nicht militärisch einsetzbar waren,
empfand die Bevölkerung als beruhigend.
In der Bundes-republik gab es während der
Blütezeit der Trolleybusse zwischen 1954 und
1957 insgesamt bis zu 52 Obus-Betriebe.
Im Saarland war
außerdem
Dieselkraftstoff teuer im Vergleich zu Strom. Neben
Völklingen entschieden sich
Saarbrücken und Neunkirchen für Oberleitungsbusse. Im
Saarland wurde der Obus meist
Trolleybus genannt, wie in England, Frankreich und der Schweiz.
Ein
kurzer Blick über die Grenzen des Saarlandes:
Am
19. Mai 1951 hatten die Forbacher Verkehrsbetriebe den Betrieb mit
vier VETRA-VBRh-Obussen auf der Strecke Kleinrosseln - Forbach- Goldene
Bremm aufgenommen. Als Wendeschleife der Forbacher Verkehrsbetriebe
diente in Kleinrosseln der Kreisverkehr vor der Grenze. Der
Obus-Betrieb wurde auf der französischen Seite wurde am 1. November
1969 eingestellt.
In Deutschland
gab es im Jahr 2019 noch Obusbetriebe in
Eberswalde, Esslingen und Solingen.
1) Die Saarbrücker Trolleybusse
Für den
öffentlichen
Personennahverkehr war der Saarbrücker Ortsteil
Alt-Saarbrücken schon immer vergleichsweise wenig
erschlossen.
Dort lag zwar
das Straßenbahndepot, aber es gab damals nur
zwei Straßenbahnlinien. Die eine führte
über den Schlossplatz und durch die Talstraße, die
zweite durch das
Deutschmühlental zur Goldenen Bremm (siehe
auch unsere Seite Straßenbahnen
2 auf der Karte
des Saarbrücker Verkehrsnetzes
1950!). Die Gebiete auf
den angrenzenden Höhen, wie etwa dem Reppersberg mit
seinem Bürgerhospital, hatten keine Straßenbahnverbindung zur
Innenstadt. Da die
französische Verkehrspolitik bereits vor dem Zweiten
Weltkrieg die Abschaffung
der Straßenbahnen beschlossen hatte, blieb für
Alt-Saarbrücken als
Nahverkehrsmittel ohne fossilen Kraftstoff nur die
Entscheidung für den Trolleybus
übrig.
|
|
In
Frankreich standardisierte
die Politik im 'Plan Pons' Vorzugs- Typen. Der
dort meistgebaute mittelgroße
Typ B hatte eine
Länge von 10 Metern bei einer Breite von 2,5m. Eindeutig führend auf dem französischen Markt war
die Vétra (Société des
Véhicules et Tracteurs Électriques),
ein Tochterunternehmen des
Elektrokonzerns Alsthom. Seit 1927 stand die Firma mit
elektrisch betriebenen
Fahrzeugen im Geschäft. Sie hatte ihren Sitz in
Paris. Dort und in Clichy
erfolgte auch die Fertigung. Der Marktanteil von
Vétra bei den Trolleybussen
betrug in Frankreich mehr als 90%.
Vermutlich
dachte man in Saarbrücken, ein Kauf beim Marktführer
könne nicht verkehrt sein.
Als die nahegelegene Stadt
Forbach
1951 den
Linienverkehr aufnahm, entschloss sie sich ebenfalls
für diesen Lieferanten.
|

|
|
Da Vétra
schwerpunktmäßig ein Elektrounternehmen war, mussten
Karosserie und mechanische
Teile auf dem Markt beschafft werden. Für den damals
aktuellen Typ VBR fertigte
das Karosseriewerk Genève in Ivry die Aufbauten, die
die Franzosen ihrer Bauart
nach “caisse poutre“ nannten. Es handelte sich dabei
um eine Variante der
selbsttragenden Karosserie ohne separates
Fahrgestell. An diese Konstruktion
konnten alle Fahrwerks- und Antriebsteile direkt
angebaut werden. Die
mechanischen Komponenten lieferte Renault. Von daher
rührt das R in der
Typenbezeichnung. Sie stammten überwiegend vom
Omnibus-Typ 215 D. Der anfangs eingebaute
Alsthom-Elektromotor war ein Verbundmotor mit einer
Stundenleistung von 100 PS;
ab 1951 gab es eine stärkere Version mit 130 PS und
doppeltem Kollektor.
|
|
 Oben:
Erster Trolleybus bei seiner Einfahrt in
Riegelsberg
Oben:
Erster Trolleybus bei seiner Einfahrt in
Riegelsberg
|
Der
Saarbrücker Trolleybusbetrieb begann am 12. November
1948. Von einer Schleife
am Hauptbahnhof aus führte die Strecke durch die
Eisenbahnstraße am Schloss
vorbei durch die Talstraße und die Feldmannstraße
hinauf zur Hohen Wacht.
Diesen Streckenabschnitt nahm man als ersten in
Betrieb, weil jetzt
der Straßenbahnbetrieb der Linie 15 ab
Eisenbahnstraße über Schloss und Talstraße bis hin
zur Feldmannstraße eingestellt wurde
(siehe
unsere Seite über die Saarbrücker Straßenbahn
im Abschnitt B!).
An der Hohen
Wacht gab es einen Abzweig zum Bürgerhospital auf
dem Reppersberg. Diese Stichstrecke mit
Wendeschleife wurde nur zu den Besuchs-Zeiten des
Krankenhauses bedient. Von der
Hohen Wacht aus ging es 1949 über die Metzer Straße
und die Eisenbahnstraße wieder
zurück zur Schleife am Hauptbahnhof. Die komplette
Ring-Strecke wurde Linie 21
genannt und konnte ab 1953 auch
im
Gegenverkehr zweispurig befahren werden.
Den Anfang
machten fünf Fahrzeuge mit jeweils 100 PS. Ab 1951
beschaffte man 12 weitere
des gleichen Typs, jedoch mit 130 PS. Sie hatten
zusätzlich einen
Hilfsgenerator eingebaut, der von einem
luftgekühlten Panhard-Motor angetrieben
wurde. Damit war ein Rangieren im Depot unabhängig
vom Fahrleitungssystem
möglich.
|
|

|
Trolleybusse und Omnibusse
hatten in Saarbrücken ursprünglich die gleiche
Farbgebung:
Elfenbein mit zwei olivfarbigen Streifen unterhalb
der Fenster (siehe im obersten Bild auf dieser
Seite und bei den Anhängern).
Zeitweise trugen
die Saarbrücker
Trolleybusse unter der Fensterlinie zwei
graue Streifen und eine Coca-Cola-Reklame in roter
Lackierung (siehe auf den drei letzten Bildern
dieses Abschnitts über die Saarbrücker
Trolleybusse). Da wollte auch
Pepsi-Cola
nicht nachstehen und bestellte eine blaue
Werbelackierung mit dem eigenen
Markenzeichen (siehe Bild links).
|
|
Die Trolleybusse
waren ausgelegt für 75 bis 80 Fahrgäste, der
Richtwert war acht Passagiere pro Quadratmeter
Innenraum. Diese Werte waren allerdings eher
theoretischer Natur. In der Praxis war das Fahrzeug
dann voll besetzt, wenn
auch beim besten Willen niemand mehr hineinpasste.
Das Lieblingswort von
Schaffner und Fahrer war ‘‘Durchrücken!“, sobald es
eng wurde. Nur so ist es zu
verstehen, dass die tatsächlich gefahrene
Personen-Beförderungs-leistung in den
Verkehrsspitzen morgens etwa 50% über der nach
Papieren überhaupt zulässigen lag.
Entsprechend
der damals vorherrschenden Philosophie der
wünschenswerten Passagierströme in
den Fahrzeugen hatten diese hinten einen breiten
Einstieg mit zwei Falttüren,
durch die man auf eine Plattform kam. Auf dieser
befand sich rechts der
Sitzplatz des Schaffners. In der Wagenmitte und
vorne war jeweils eine Falttür
für den Ausstieg vorhanden.
|

|
|
|
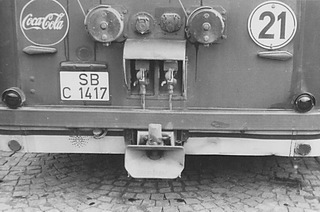
|
Bild
links: Zum Anhängerbetrieb
rüstete man die Trolleybusse mit
vollautomatischen Rockinger-Kupplungen und
Anschlüssen für eine
Zweileitungs-Druckluftbremse nach.
Bemerkenswert sind auch die
ursprünglichen, roten
Fahrtrichtungsanzeiger in Pfeilform,
jeweils unter der Cola-Werbung und unter
der Linien-Nummer "21".
Am
14.November 1953 wurde die etwas mehr als 14
km lange Strecke zwischen
Hauptbahnhof Saarbrücken
und
Heusweiler in Betrieb genommen. Die Bauzeit
betrug 255 Tage.
In
Heusweiler war die
Endschleife in der dortigen Trierer Straße.
Die
Strecke erhielt die Liniennummer 10. Ab 1958
fuhr sie bis 1962 über den Hauptbahnhof
hinaus weiter bis zum Bürgerhospital auf dem
Reppersberg.
|
|
1954
wurden
auf den Linien 21 und 10 mit siebzehn
Trolleybussen 5,8 Mio Passagiere befördert,
im
Vergleich dazu reisten im gesamten
Omnibusnetz mit 48 Fahrzeugen 10,1 Mio
Fahrgäste. Da
die Passagierzahlen beim Trolleybus weiter
anstiegen, erfolgte ab November 1956
ihr Einsatz mit vier neu gekauften Anhängern
des Typs OB53 von Vetter/Schenk.
Sie hatten je 23 Sitz- und fünf Stehplätze.
Die 130 PS-Trolleybusse zogen sie auf
der Linie 21 ohne Probleme über den
Reppersberg. Der Versuch, auch im
Omnibusbetrieb mit den Anhängern zu fahren,
scheiterte: Motorleistung und
Antriebsstrang der Chausson-Omnibusse waren
zu schwach dafür. Ab Mitte 1960 war die
Personen-Beförderung in Anhängern nach
bundesdeutschem Straßenverkehrsrecht nicht
mehr zulässig. Die vorhandenen Anhänger
konnten mit je rund 100.000 km Laufleistung
noch 1959 alle zusammen nach
Lausanne verkauft werden.
|

|
Mit dem
wirtschaftlichen Anschluss am Tag X galten
die Steuergesetze der
Bundesrepublik. Für die Trolleybusse wurde
zwar keine Kfz- Steuer, aber jetzt
eine Straßennutzungsgebühr fällig, die ihren
Betrieb weniger wirtschaftlich machte; zudem
fuhren sie weiterhin mit
Schaffnern.
|
|
Die nach
dem
Tag X neu gekauften MAN-Omnibusse waren ab
Werk für den Einmannbetrieb mit einem damit
verbundenen Passagierfluss von vorne nach
hinten ausgelegt.
Da
Dieselkraftstoff günstig auf dem Markt
erhältlich war, stellte man zunächst am
29. November 1962 die Linie 21 zur Hohen
Wacht auf Omnibusbetrieb um, und dann
am 12. Mai 1964 auch die mehr als 14 km
lange Strecke nach Heusweiler. Als
Ironie des Schicksals ist sicher die
Tatsache zu werten, dass der
Straßenbahnverkehr in
Saarbrücken erst
später, nämlich am 22. Mai 1965,
eingestellt wurde. Im Fuhrpark befanden sich
danach nur noch 221 Omnibusse, die
ausschließlich von Chausson und MAN
hergestellt waren.
Da man
für die siebzehn noch vorhandenen
Trolleybusse keine Käufer mehr finden
konnte, wurden sie alle verschrottet. Der
Omnibus mit Verbrennungsmotor hatte den
Markt für die
gleislose Personenbeförderung auf der Straße
nahezu vollständig erobert.
|

|
|
Schon
ab
Mitte der 50er Jahre rüstete Vétra nur noch
Omnibusse von Chausson und Berliet
mit elektrischen Antrieben aus. Es gab keine
eigenen Fahrzeugtypen mehr im
Programm. 1964 stellte die Firma auch dieses
Geschäft wegen fehlender Aufträge ein.
------------------------------
Verwendete
und empfohlene Literatur:
Sonderdruck:
75 Jahre Gesellschaft für Straßenbahnen im
Saartal AG, 1892-1967; Sonderdruck: 100
bewegte Jahre, die Saartal-Linien, 1892-1992
Janson, Karl Heinz: Die Riegelsberger
Straßenbahn, Sutton Verlag 2011.
|
|
2) Trolleybusse in
Völklingen
Am
12. November 1950 ging im Bereich der
Stadtwerke Völklingen (SWV) die erste
Obus-Strecke in Betrieb. Sie verband
Völklingen mit Püttlingen. Die Fahrleitungen
hatten die Stadtwerke in Eigenregie
montiert, die Planung lag bei Saar
Brown Boveri GmbH (BBC).
Der
Bildtext der Saarbrücker Zeitung vom
14.11.1950 unter dem Foto rechts lautete:
"Wie
wir in unserer gestrigen Ausgabe
berichteten, wurde die Trolleybus-Linie
Völklingen-Püttlingen eingeweiht. Unser
Bild zeigt den Bus beim Start zur
Jungfernfahrt.
Photo:
"SZ"
|

|
|

|
Am 29.
Juni 1952 wurde die Strecke von Völklingen
nach Wadgassen eröffnet.
Das
Bild links ist bei der feierlichen Einweihung
dieser Strecke mit SOMUA-Obussen
entstanden.
Man
sieht mehrere neue Trolleybusse der Stadtwerke
Völklingen hintereinanderstehen.
|
|
Am 29.
September 1954 war die Obus-Linie Völklingen-
Ludweiler über Rotweg betriebsbereit. Die
Straßen-bahnlinien nach Großrosseln und
Ludweiler führten bisher von der Stadtmitte
zum Rotweg und gabelten sich dort. Der
Straßenbahnverkehr nach Ludweiler wurde mit
Aufnahme des Obusbetriebs eingestellt.
Zwischen Stadtmitte und Rotweg fuhren
Straßenbahn
nach Großrosseln und Obus nach Ludweiler ab
diesem Zeitpunkt auf der gleichen Strecke. Der
Start des Obusverkehrs ab Rotweg nach
Großrosseln erfolgte am 19.4.1959 und
ermöglichte dann die vollständige Einstellung
des Straßenbahnbetriebs. Die Wendeschleife lag
unmittelbar an der Grenze.
29. September 1954: Festlich
geschmückt fahren die ersten Trolleybusse
vom Ev. Gemeindehaus
Ludweiler nach Völklingen.
|

|
|
Die ersten zehn Obusse
in Völklingen hatten SOMUA-Fahrgestelle,
Aufbauten von
Million-Guiet und eine elektrische Ausrüstung
von Schneider-Westinghouse. Außerdem
beschaffte man für diese Fahrzeuge noch einen
(einzigen!) Anhänger. Die 75-kW-Verbundmotoren
lieferte Westinghouse. Zur Schleichfahrt ohne
Fahrleitung, über wenige hundert Meter durch
die niedrige Unterführung am Bahnhof, war ein
Akkusatz eingebaut.
Zur Schleichfahrt ohne Fahrleitung,
über wenige hundert Meter durch die niedrige
Unterführung am Bahnhof, war ein Akkusatz
eingebaut. Das Ab- und Andrahten der
Stromabnehmer war jeweils Aufgabe des
Schaffners. Dies berichten die
Zeitzeugen Hans-Georg Altmeyer
und Ludwig Hamm.
|
|

Die neuen Henschel-Obusse wurden
mit der Bahn nach Völklingen transportiert.
|
Ab 1958
kamen acht Henschel-Obusse HS 160 OSL
mit Kiepe-Steuerung dazu. Sechs dieser
Fahrzeuge hatten Doppelkollektormotoren mit
103 kW von Westinghouse, und zwei Fahrzeuge
verfügten über Garbe-Lahmeyer-Verbundmotoren
mit 105 kW.
Mit
ihrer selbsttragenden Aluminiumkarosserie und
der Luftfederung galten die Frontlenker als
hochmodern.
Die
neuen Obusse waren zusätzlich mit einem
Hilfsgenerator ausgerüstet, der von einem
VW-Motor angetrieben wurde. Mit dessen Hilfe konnte man nun auch ohne Verbindung zu der Fahrleitung
sowohl die Unterführung am
Bahnhof Völklingen überqueren, als auch später in Wadgassen die Eisenbahnstrecke
zwischen Hostenbach und Überherrn.
Außerdem
war es dadurch ebenfalls möglich, mit den Obussen
im Depot zu rangieren.
|
Alle SOMUA
und Henschel-Oberleitungsbusse verfügten über einen
abgetrennten Schaffnerplatz am hinteren Einstieg. Von
dort aus konnten auch die Türen geöffnet und
geschlossen
werden. Die Kommunikation mit dem
Fahrer erfolgte durch Klingelzeichen.
|

Letzte Straßenbahnfahrt nach
Großrosseln. Die Obusse stehen schon bereit.
|
Die
Verkehrsbetriebe fuhren nach dem Krieg
zunächst alle Fahrzeuge im Zweimann- oder
Schaffnerbetrieb. Die Omnibusse hatten im
Heck eine Tür, die der Schaffner manuell
betätigte. Er stieg in der Regel hinten ein,
schloss die Tür, zog an einer Lederleine,
die mit einer Klingel in der Nähe des
Fahrers verbunden war und rief laut "fertig
am Schluss", worauf sich der Bus in Bewegung
setzte. Der arme Schaffner hatte zwei Taschen
umhängen, eine rechteckige kofferartige, die
verschiedenfarbige Fahrscheinblöcke
enthielt, und eine lederne Geldtasche mit
einem Münzspeicher, dem so genannten "Galoppwechsler",
auf der Vorderseite.
Die
Straßenbahnschaffner hatten dieselbe
Ausrüstung und zwängten sich ebenso durch
die Wagen, um Fahrscheine zu verkaufen.
Außerdem mussten sie mit einer langen Stange
die mechanischen Weichen stellen.
Trolleybusse
waren die ersten Fahrzeuge im Saarland mit
einem separaten "Schaffnerplatz" im Heck.
|
|
Basis
hierfür war die Einführung des Prinzips
"Fahrgastfluss" vom Einstieg hinten zu den
Ausstiegen in der Mitte und vorne. Aufgabe des
hinten im Trolleybus sitzenden Schaffners war
es außerdem auszusteigen, wenn die
Stromabnehmer abgesenkt, gesichert und wieder
"eingedrahtet" werden mussten. Nach 1952
hatten auch die neuen Omnibusse einen
separaten
Schaffnerplatz. Dieser wurde in den älteren
Fahrzeugen ab 1964 mit der Einführung des
Einmannbetriebs und der damit verbundenen
Umkehr des Fahrgastflusses, jetzt von vorne
nach hinten, nicht mehr besetzt.
|
|
Wenn
ein Fahrgast schon einen Fahrschein oder gar
eine Monatskarte hatte, durfte er auch vorne
beim Fahrer
einsteigen. Verglichen mit dem "freilaufenden"
Schaffner
war der Schaffnerplatz im Heck der SOMUAs für
das Personal ein großer
Fortschritt. Den Schaffnerplatz gab es später
auch in den Omnibussen. Die
CHAUSSON AP522 und die wenigen Völklinger
Floirat-Busse waren so gebaut. (Außer
Schaffnern gab es damals natürlich
auch Schaffnerinnen.)
Bei den
Überlandstrecken der Post waren die
Haltestellenabstände viel
größer. Da konnte man durchaus im
Einmannbetrieb fahren und längere
Haltezeiten einplanen. Einige Dörfer im Warndt
hatten nur eine einzige
Haltestelle. Etwa 1960 begann der
Einmannbetrieb der Stadtbusse. Ein
Schild vorne hinter der Scheibe zeigte an:
Einmannwagen. Der Schaffnerplatz
blieb anfangs einfach unbesetzt. Später wurde
er ausgebaut.
Bereits
1964 ist die Strecke nach Wadgassen auf
Omnibusbetrieb umgestellt worden, 1966 die
Linie nach
Ludweiler. 1967 wurde auch der Verkehr mit
Obussen nach Püttlingen und Großrosseln
aufgegeben.
|
|

Die
Karawane der neuen Henschel-Fahrzeuge in
Großrosseln, Blick in Richtung Rossel und
Grenze. Durch die Unterführung kommt man
nach Petite-Rosselle.
|
|
|
Ausschlaggebend
waren dafür wirtschaft-liche
Gründe: Das Oberleitungsnetz musste unterhalten
werden, die Fahrzeuge wurden im
Schaffnerbetrieb gefahren, Dieselkraftstoff
war inzwischen preisgüns-tiger geworden, und
die Obusse wurden in der Bundesrepublik mit einer
staatlichen "Verkehrsabgabe“ belegt - sie hatten ja
keinen Hubraum, der besteuert werden
konnte. Ökologische Betrachtungen von damals sind
nicht überliefert.
Die SOMUA
Fahrzeuge wurden nach ihrer Aussonderung verschrottet,
die Henschel-Busse erhielten
MAN-Unterflur-Diesel-Motoren,
dazu Schaltgetriebe, und wurden auf Einmannbetrieb mit
Fahrschein-entwerter
umgebaut.
|

|
|
Der
automatisierte Einmannbetrieb wurde 1964 - als
bundesweit wegweisende Neuerung - zuerst in Völklingen
eingeführt. Möglich geworden war er durch den Einsatz
der neuentwickelten Entwerter mit Stempelung. Von nun
an
durfte man, so im Besitz einer Fahrkarte, auch durch
die Mittel- und Hecktüren
einsteigen.
|
|
Ab 1960 konnte
man die Endschleife in Wadgassens Lindenstraße nur
noch mit den Trolleybussen von Henschel anfahren. Die
Eisenbahnstrecke Hosten- bach-Überherrn war
elektrifiziert worden. Deshalb musste man das
Fahrleitungssystem des Trolleybus über den
schienengleichen Bahnübergang an der Ortsgrenze zu
Hostenbach entfernen.
Die Henschel
HS160 hatten einen eingebauten Hilfsgenerator, mit
dessen Leistung sie die kurze Strecke über den
Bahnübergang auch ohne Fahrleitung langsam zurücklegen
konnten. Das notwendige Einziehen und sichere
Einklinken der Stromabnehmerstangen am Ende des
Fahrzeug- daches erledigte der Schaffner, der während der
Fahrt hinten saß. Jenseits des Bahnübergangs
legte er die Stromabnehmer wieder an das
Fahrleitungs- System an.
|

|
|
Bild
oben: Hier biegt ein Völklinger Trolleybus
an der Endschleife in Wadgassen in die Hauptstraße
ein. (Dieses Foto
stammt aus den 60er-Jahren)
|
|
Interessant ist das Bild rechts
mit den geöffneten Frontklappen und dem Blick auf
den riesigen Fahrschalter: mechanisch und
elektrisch ein anspruchsvolles Gebilde - und dazu
noch wartungsintensiv.
----------------------------------------------------------
Verwendete
Literatur:
Sonderdruck der
Stadtwerke: 75 Jahre Nahverkehr in
Völklingen,1909-1984
Werner
Konter: Erinnerungen an die Straßenbahn.
Logos-Verlag Saarbrücken 1992
Sämtliche
Fotos der
Völklinger Trolleybusse: Heimatkundlicher Verein
Warndt e.V. (HVW)
|

|
3)
Neunkircher Trolleybusse
Die
Karte zeigt das Streckennetz
der Neunkircher Straßenbahn
AG:
|
|
Neunkirchen war
die dritte und letzte Stadt im Saarland, die sich für
den teilweisen Ersatz der Straßenbahn durch
Trolleybusse
entschied. Es war gleichzeitig der drittletzte
Verkehrsbetrieb in Deutschland,
der auf Obusse umstellte. Für Neunkirchen lagen die
Gründe auf der Hand: die dauernden
Schäden durch Grubensenkungen an den Gleisanlagen der
Straßenbahn und die
Unmöglichkeit, in Frankreich neue Fahrzeuge für diese
zu beschaffen.
Die
saarländische Regierung unterstützte das Projekt mit
einem Darlehen von insgesamt 168 Mio. Franken, das die
Grube Reden um weitere
acht Mio erhöhte, weil sie ein großes Interesse daran
hatte.
Am 3. August
1952 begann die Umstellung auf dem Streckenabschnitt
Landsweiler - Heiligenwald. Erst eine Zeit danach
folgte die Fortsetzung der Strecke in Richtung
Innenstadt bis zum
Stummdenkmal. Am 1. August 1953 startete der
planmäßige Linienverkehr auf der
Gesamtstrecke.
|
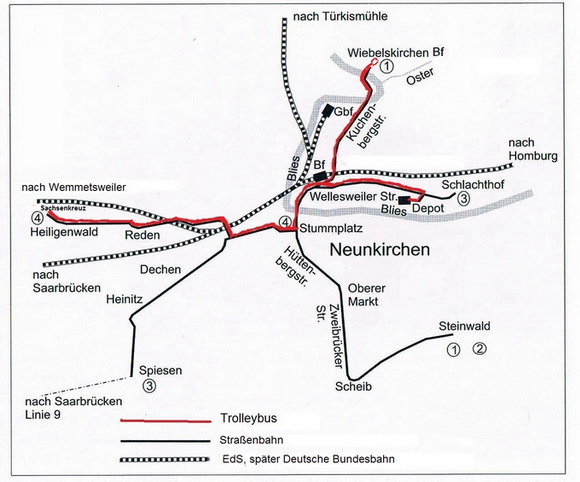
|
|

|
Am 11. Mai 1954
konnte der Betrieb zwischen Stummdenkmal und
Bahnhof Wiebelskirchen aufgenommen werden. Über einen
Abzweig an dieser Strecke erfolgte die Zufahrt zum
Depot an der Wellesweiler Straße.
Den
Fahrleitungsbau und die Errichtung der Unterstationen
zur Stromversorgung übernahm die Saar
Brown Boveri aus Saarbrücken, die zuvor eine
Niederlassung der BBC in Mannheim
war, jetzt aber geschickt als eigenständiges
Unternehmen agierte und einen Teil
ihres Geschäftes als Filiale der französischen
Compagnie Electromécanique (CEM) abwickelte. Die Saar
Brown Boveri hatte bereits vergleichbare Arbeiten bei
der Einführung der Trolleybusse in Saarbrücken und
Völklingen übernommen.
Die Einstellung
des Straßenbahnverkehrs in Neunkirchen war
übrigens damals nicht beabsichtigt, weil man einen
Busverkehr über den Hüttenberg aus Sicherheitsgründen
für nicht durchführbar hielt.
|
|
Da die
Neunkircher Straßenbahn zeitweise mit drei
unterschiedlichen und nicht kompatiblen Stromabnehmern
fuhr, entstand am
Stummplatz durch die jetzt noch hinzukommenden
Obus-Fahrleitungen ein bemerkenswerter
Drahtverhau an Oberleitungen. Erst 1959 stellte man
die Straßenbahn komplett
auf Scherenstromabnehmer um. Die Bürger freuten sich,
denn durch diese Maßnahme
konnten die Störungen des gerade aufblühenden
Fernsehempfangs durch die
Stromabnehmer drastisch reduziert
werden.
Mit den
Fahrzeugen ging man auf Nummer sicher. Am Anfang
standen
fünf Fahrzeuge vom Typ VBRh des französischen
Quasi-Monopolisten Vétra zur
Verfügung und ab 1954 vier weitere Fahrzeuge dieses
Typs für die Bedienung der
Strecke nach Wiebelskirchen. Ihn setzten auch Städte
wie Forbach, Metz und
Saarbrücken ein. Details sind im Abschnitt über die Saarbrücker Trolleybusse
beschrieben.
|

|
|
 Die
vorhandenen neun Fahrzeuge reichten in Neunkirchen
aber nach wie vor nicht aus. Daher wurde für das
Teilstück zwischen Hauptbahnhof und
Stummdenkmal eine besondere Betriebsvorschrift
erlassen, nach der stets direkt
hinter dem Trolleybus ein Straßenbahnzug zu fahren
hatte. In Gegenrichtung fuhr
die Straßenbahn vorweg. Das Foto einer solchen
Kombination vor dem Eisenwerk
entstand also keineswegs zufällig, sondern gemäß
Fahrdienstanweisung. Die
vorhandenen neun Fahrzeuge reichten in Neunkirchen
aber nach wie vor nicht aus. Daher wurde für das
Teilstück zwischen Hauptbahnhof und
Stummdenkmal eine besondere Betriebsvorschrift
erlassen, nach der stets direkt
hinter dem Trolleybus ein Straßenbahnzug zu fahren
hatte. In Gegenrichtung fuhr
die Straßenbahn vorweg. Das Foto einer solchen
Kombination vor dem Eisenwerk
entstand also keineswegs zufällig, sondern gemäß
Fahrdienstanweisung.
Mitte der 50er-
Jahre war die Transportleistung in Neunkirchen mit
den Trolleybussen fast ebenso hoch wie die mit den
Straßenbahnen. Der Zuwachs an
Fahrgästen und die Verdichtung des Personennahverkehrs
waren nur noch mit
zusätzlichen Fahrzeugen möglich.
Ein
Trolleybus hält in der Saarbrücker Straße an der
Haltestelle Stummplatz hinter einer Straßenbahn mit
Anhänger.
|
|

|
Abhilfe schufen
zwei große Dreiachser des Typs VA3B2 von Berliet /
Vétra /Alsthom. Sie waren die größten
Trolleybusse auf dem französischen Markt und eine
Variante des Diesel-Omnibusses PBR von Berliet
(identisch mit dem Berliet-Typ EBR). Vétra hatte den
Bau kompletter eigener Fahrzeuge bereits eingestellt
und belieferte Berliet nur noch mit den erforderlichen
elektrischen Komponenten; ausgenommen waren Motore,
die direkt von Alsthom kamen.
Die
Trolleybusse wurden komplett bei Berliet im Werk
Vénissieux nahe Lyon gebaut.
Sie wogen leer schon 12 Tonnen, hatten ein zulässiges
Gesamtgewicht von 19,9 t und
waren 12 m lang. Nach damaligen französischen
Vorschriften mussten alle
Fahrzeuge über 11 m Länge mit drei Achsen
ausgestattet sein, so auch diese. Die Lenkung erfolgte
mit
Druckluft-Unterstützung, und die Motorleistung bertrug
103 kW (140 PS).
|
|
Die Motore
waren Doppelkollektor-Verbundmaschinen des Typs TA
635A von Alsthom. Die Hinterachsen waren einfach
bereift; sie wurden aber wegen der drehmomentstarken
Motoren beide angetrieben. Die
Trolleybusse konnten 102 Fahrgäste befördern und
maximal 55 km/h schnell fahren.
In Lyon waren
mehr als 140 dieser großen Fahrzeuge im Einsatz.
Um nicht nur
die Beförderungsleistung erhöhen, sondern auch, um die
Fahrzeugfolge verdichten zu können, musste man
zusätzliche Wagen beschaffen. Als Farbe für diese und
auch für die bereits vorhandenen legte
man eine einheitliche Lackierung in Elfenbein fest.
Unterhalb der Fensterlinie
erhielten sie olivgrüne Streifen (siehe Foto>).
|

|
|
1958 war die
Trolleybus-Euphorie in Europa bereits wieder vorbei.
Diesel-Omnibusse konnten nun billiger betrieben
werden.
Auch z.B. in
Bremerhaven hatte man den Trolleybus-betrieb bereits
eingestellt. Die dortigen Fahrzeuge waren 1947 gebaut
worden; es waren aber noch Kriegs-Einheits-Obusse des
Typs II (KEO, siehe Bild rechts).
Vermutlich war deren Preis sehr günstig, als sie nach
Neunkirchen verkauft wurden, obwohl sie, da aus der
Bundesrepublik importiert, noch verzollt werden
mussten.
Alle Fahrzeuge
waren für Anhängerbetrieb ausgelegt, wurden aber
später in
Neunkirchen nur ohne Anhänger gefahren.
Die elektrische
Ausrüstung
war standardisiert. Die Komponenten waren austauschbar
und stammten fast
ausschließlich von AEG, BBC oder SIEMENS.
|

|
|
|
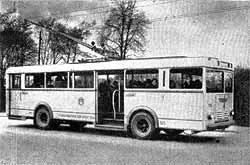
|
Die
Doppelkollektor-Motoren leisteten
jeweils 2x rund 45 kW, bei 1500 Umdrehungen
pro Minute. Die maximale Drehzahl
betrug 3000 Umdrehungen pro Minute.
Die
Obusse hatten auf beiden Achsen
Zwillingsbereifung.
Kleine Reifen mit der nötigen Tragfähigkeit
für Einzelbereifung standen damals nicht
zur Verfügung. Ein Obus mit Zwillingsreifen
auf der Vorderachse lässt sich jedoch
nur mit einer Lenkhilfe fahren, die man in
Kriegszeiten als eher
überflüssiges Bauteil hätte ansehen können.
<
KEO
Normgröße II (Foto: Sammlung DVN ©)
|
Dank dieser
Technik war das Lenken im Vergleich zu
Fahrzeugen ohne diese Unterstützung erheblich
leichter. Und erstmals, wichtig während des Krieges,
konnten jetzt auch Frauen am
Steuer eingesetzt werden.
Die Neunkircher
Fahrzeuge bestanden komplett aus
Stahlblechen, da sie nach Kriegsende gebaut und die
Kriegsbauweise unter Verwendung
von Pressholz nur eine Notlösung war. Ihre Vorderachse
baute man in Neunkirchen
in der eigenen Werkstatt auf Einzelbereifung um.
Reifen geeigneter
Tragfähigkeit waren in der zweiten Hälfte der 50er
Jahre wieder problemlos zu
beschaffen.
Die vorne
eingebauten mechanischen Sand-Streuvorrichtungen
blieben erstaunlicherweise erhalten. Ebenfalls in
Eigenregie wurden den Fahrzeugen leicht schräg
gestellte, plane Frontscheiben eingebaut, und die
Winker wurden durch
Blinker ersetzt.
Insgesamt
entstanden ab
1944 von diesem Wagentyp 220 Trolleybusse in Normgröße
II auf Henschel
Fahrgestellen. Sie bekamen überwiegend Aufbauten von
Kässbohrer in Ulm oder von
Schumann in Werdau nahe Zwickau und wurden an 44
Obusbetriebe geliefert.
Mit ihrem und
dem daraus weiterentwickelten
Henschel-Fahrgestell „II-6500“ wurden bis 1956
insgesamt 518 Obusse ausgerüstet.
Es ist das meistgebaute Obusfahrgestell Deutschlands.
-----------------------------------------
Verwendete
Publikationen:
Neunkircher
Verkehrs AG
(Hrsg.): Zwischen Kurbel und Lenkrad
(1907–2007). 100 Jahre ÖPNV in Neunkirchen. Ottweiler
Druckerei&Verlag 2007
Werner Konter:
Erinnerungen an die Straßenbahn. Logos Verlag,
Saarbrücken 1992
Christophe
Puvillard :
Berliet 1905-1978, toute la gamme omnibus, autocars,
autobus et trolleybus. Histoire et Collections, Paris
2008
Michael
Kochems, Dieter Höltge: Straßen- und
Stadtbahnen in Deutschland, Band 12 Rheinland-Pfalz
und Saarland. EK-Verlag Freiburg, 2011
|
|
|
> Übersichts-Seite
des Kapitels VERKEHR
nach oben

|
 zurück
<---------> weiter zurück
<---------> weiter 
wwwonline-casino.de
(Gesamt seit 2008)
Home
(zur Startseite) > www.saar-nostalgie.de
|