|
Bei Übergabe erfolgte eine Einweisung durch den Verkäufer in die Bedienung des Fahrzeugs. Diese fand
ihren Abschluss in der eindringlichen Ermahnung, die Wartungs- und besonders die Einfahrvorschriften und
zu beachten. Nach diesen galten
z.B. beim Renault 4 CV folgende Höchstgeschwindigkeiten in den
einzelnen Gängen während der ersten 1000 km: Erster Gang: 16 km/h,
zweiter Gang: 32 km/h, dritter Gang: 55 km/h. Anschließend bis 2000 km
Laufleistung: nicht schneller als 70 km/h. Außerdem: im dritten Gang
nicht langsamer als 40 km/h, im zweiten Gang nicht unter 10 km/h.
Für die anderen
Verkehrsteilnehmer war oft an der Heckscheibe als Information ein Aufkleber mit
der Aufschrift “en rodage“ ("wird eingefahren") angebracht, um die auffällige Fahrweise zu erklären.
Es waren wahrlich gemütliche Zeiten. Aber schon nach maximal gefahrenen 500 oder 1000 km
war der erste Ölwechsel fällig.
Verließ
man als frischgebackener Autobesitzer das
Firmengelände mit seinem neuen Wagen, endete die Fahrt gleich an der
nächstgelegenen Tankstelle. Es war gut, hier den Ermahnungen des
Verkäufers zu folgen, denn dem Neuwagen war Kraftstoff nur in
homöopathischen Mengen eingefüllt worden.
|
An der Tankstelle
Mit
dem Besitz eines Autos wurde der Tankwart automatisch zu einer neuen
Bezugsperson. Hatte man doch vorher schon stundenlang in der
Männer-Runde am Stammtisch diskutiert, welche Kraftstoffmarke nun die
beste sei, stand damit nun eine ernste Entscheidung für den Besitzer
an: die Stamm-Ttankstelle.
Es
ging ja nicht nur um das Tanken, das hätte man auch an der
Bürgersteig-Zapfsäule des ortsansässigen Zweiradhändlers erledigen
können oder bei einer der hin und wieder am Straßenrand anzutreffenden so genannten
“eisernen Jungfrauen", Zapfsäulen mit Handpumpe und zwei Fünf-Liter-Glasgefäßen. Schmierstoffe wurden im dazugehörigen Laden verkauft.
|
Shell-Tankstelle in Saarbrücken-Burbach 1956 (Foto: Landesarchiv Saarbrücken)

|
|
Es ging um mehr: Nach jeweils 2.500 gefahrenen Kilometern wurde der lapidare Auftrag an einen Tankwart fällig: Ölwechsel und Abschmieren!
|
|

|
Dazu
war eine Hebebühne oder mindestens eine Abschmiergrube notwendig. Dies
war die Billiglösung; eigentlich sollten die Schmierstellen beim
Abschmieren entlastet sein. Dafür konnte die Grube aber meist auch von
LKWs befahren werden. Vornehm war eine Hochdruck-Abschmierpresse mit
Druckluftanschluss.
PKWs hatten etliche
Schmiernippel, und diese saßen bei den verschiedenen Typen jeweils an einer anderen Stelle. Deshalb gab es an der
Tankstelle einen von der Mineralölgesellschaft herausgegebenen Ordner mit
Schmier- und Wartungsplänen. Außerdem enthielt er die markenspezifischen
Vorschriften für die zulässigen Schmierstoffe. Bei den Motorölen war das
relativ einfach, sie waren damals nur gering mit Zusätzen (Additiven) versehen,
"legiert", nennt man das. Wesentlich war die Viskosität, also das Fließverhalten bei
unterschiedlichen Temperaturen. In der Regel war im Sommer Öl der Viskosität
SAE 30 vorgeschrieben, im Winter SAE 20 oder SAE10. Ende der 60er gab es dann auch
Mehrbereichsöle SAE 10W30 oder 20W50, die einen Ölwechsel je nach Jahreszeit
überflüssig machten.
Altöl
war keineswegs
immer Sondermüll. Ein Tipp war, den Verfall der Fahrzeuge aufgrund von
Rost durch Einsprühen des Fahrzeugunterbodens mit Altöl oder Kriechöl
aufzuhalten. Dafür sollte der Unterboden vorher gesäubert und dann
durch eine kleine
Ausfahrt mit Sand bestäubt werden. Anschließend erfolgte die Öldusche.
Die
Arbeit war sicher ungesund und der Nutzen fraglich.
Tankstellen-Ensemble (Foto
mit freundlicher Genehmigung von http://alte-tanksaeulen.de)
|
Eine fortschrittliche Tankstelle hatte neben der
Arbeitshalle zusätzlich noch eine wandhoch geflieste Waschhalle. Von großem Vorteil war
es, wenn eine Tankstelle auch ein Batterieladegerät oder noch besser einen Schnelllader
besaß. Nach der ersten frostigen Nacht konnte man Kinder beobachten, die mit
Vaters Autobatterie im Bollerwagen zum Aufladen an die Tankstelle geschickt
wurden. Manche gut behütete Batterie brachte die kalten Winternächte
vorsichtshalber in der Küche zu.
|

|
Damals
wurde auch das Kühlwasser der Autos gewechselt. Im Sommer fuhr man mit
reinem Wasser, im Winter mit einem Wasser/Glycol-Gemisch. Die
Brühe wurde im Frühjahr abgelassen und für den nächsten Winter
aufbewahrt.
Leute aus konservativen Kreisen fuhren im Winter sogar noch mit
Brennspiritus als
Frostschutz im Kühlwasser. Teil der Ausstattung war bei vielen
Fahrzeugen
schwarze Pappe, die im Winter zwecks Minderung der Kühlwirkung vor dem
Kühler
angebracht wurde. Besondere Freude bereitete diese Prozedur den
Besitzern des
Crèmeschnittchens. Es hatte den Kühler hinter der Rücksitzbank im Heck
und
benötigte gleich zwei eigens vorgeformte Pappen, die eingefieselt
werden
mussten.
An
der Zapfsäule gab es keine Selbstbedienung. Der Tankwart trug oft die
Uniform der Mineralölgesellschaft, und einen Shop suchte man vergebens,
es sei denn, es handelte sich um
Schmierstoffe, Keilriemen, Zündkerzen, Auto-Glühlampen und ähnliche für
das
Wohlbefinden des Fahrzeugs erforderliche Produkte.
< Zapfsäule
mit Handpumpe und Glasbehältern
Zapfsäule
mit seitlicher Rückstellkurbel für Zählwerk >
Diese drei Fotos zeigen wir hier mit der freundlichen Genehmigung von http://alte-tanksaeulen.de
|

|
|
Zwischen den Tanksäulen für Benzin und Super stand das “Ölkabinett“, ein Schrank mit zwei oder drei
Handpumpen, mit denen man Motoröl unterschiedlicher Viskosität in Blechkannen
mit 0,25 l, 0,5 l oder einem Liter Inhalt abfüllen konnte (siehe Bild rechts). Später ging man zu
abschließbaren Schränken über, die Öle in Blechdosen enthielten. Es gab
Auto-Modelle mit berüchtigt hohem Ölkonsum. Verdächtigte man einen
Panhard-Fahrer mit bläuendem Auspuff, einen Zweitakter zu fahren, hatte man
sich damit einen Feind für sein weiteres Leben geschaffen. - Als normal galt ein
Ölverbrauch von einem Liter auf 1.000 km.
War die Tankstelle groß
oder auf dem Dorf, so hatte sie neben denen für Normal- und Super- kraftstoff
eine dritte Zapfsäule für Diesel. Diesel - PKWs waren bis Ende der 50er Raritäten
und von Mercedes-Benz. |

|
Mancher Traktor oder LKW war allerdings auf
Dieselkraftstoff angewiesen. Die Diesel-Säulen waren nach
amerikanischem Vorbild oft etwas weiter entfernt auf dem
Tankstellengelände aufgestellt.
Viele
leichte und mittlere LKWs, z.B. die von Renault, hatten Benzinmotoren.
Zur Standard- ausstattung der Tankstelle gehörte eine blecherne
Mischkanne zum Ansetzen des Zweitakt-Gemischs für DKWs und die
motorisierten Zweiräder.
Zum
Mischen mit der Kanne brauchte man die richtige Menge Motoröl SAE 30
für 10 l Kraftstoff und einen kräftigen Arm. Oftmals wurde ein Gemisch
1:25 für Zweiräder bereits automatisch in einer fahrbaren Säule mit
Tank und Pumpe hergestellt.
|
|
Unverzichtbar war für die Tankstelle eine
Druckluft-Erzeugungsanlage. Sie diente vorwiegend zum Füllen von Reifen und
lieferte die Luft für die Abschmierpresse, den Ölsprüher und die Steuerung der
Hebebühne.
Das
Geschäft mit den
Kraftstoffen war fest in der Hand der bunten “großen Schwestern“, wie
Shell,
Esso und BP, die bis heute am Markt sind. In Frankreich und im Saarland
hatte
Total mit seinen Tochtergesellschaften eine starke Position. So fehlte
auf kaum
einem Neufahrzeug der Hinweis per Aufkleber, man solle Total-Kraft- und
Schmierstoffe verwenden. Die Kraftstoffe waren markenspezifisch gelb,
rot oder
grün gefärbt. Jede große Marke hatte ihre eigenen Raffinerien in
Frankreich mit
nachgeschalteter Tanklager- und Transportlogistik. Markenkraftstoff
wurde mit Bahn-Kesselwagen zu Tanklagern transportiert und von dort per
Tanklastzug
ausgeliefert. So entstand ein beliebtes Thema für den Stammtisch:
Welche
Kraftstoffmarke ist besser? Läuft mein Auto mit Super schneller als mit
Normal?
Es gab in der Tat Unterschiede zwischen den Marken aufgrund der
Produktionsprozesse ihrer Raffinerien und der unterschiedlichen
Additive.
Bisweilen gab es auch “Klingelwasser“, das war Kraftstoff, der sich bei
entsprechender
Motorbelastung aufgrund ihrer nach unten
grenzwertigen Oktanzahl lautstark durch metallisches Geräusch, das
"Motorklingeln“, bemerkbar machte. Heute nutzen die Mineralölkonzerne
gemeinsam zentrale Tanklager. Der Marken- kraftstoff
entsteht erst beim Befüllen der Tanklastzüge durch automatische Zugabe
markenspezifischer Additive.
Es gab damals noch keine freien Tankstellen. Sie entstanden erst in den 60er-Jahren, als Kraftstoff im
Überfluss in Rotterdam auf dem Spot-Markt zu beziehen war. Im Saarstaat
firmierten aber lokale Mineralöl-Importeure mit eigenen Tankstellen, wie etwa
Widenmeyer in Saarbrücken (Abbildung unten).
|

|
|

Im November 1956 wurden die Tankstellenbesitzer zu den wichtigsten Personen im Saarstaat. Die
Suez-Krise führte zu drastischer Benzinverknappung. Anfangs wurden Nummern
ausgegeben (wie heute in manchen Arztpraxen), damit die Reihenfolge geklärt war,
in der der kostbare Stoff im Falle einer Belieferung an Stammkunden verteilt
werden sollte. Es durften jeweils nur noch fünf bis maximal zehn Liter Kraftstoff pro Fahrzeug abgegeben werden.
Diese
Menge sollte die Wochenration darstellen. Nicht-Stammkunden der
Tankstellen hatten keine Chance. Die Benzinpreise waren zwar erhöht
worden, aber vom Staat festgesetzt. Es gab also kein Regulativ durch
Angebot
und Nachfrage. Die Tankwarte rieten ihren Stammkunden dazu,
jenseits der Grenze zu tanken, und taten dies sogar selbst.
Flugs
waren auch grenznahe Städte in der Bundesrepublik, wie das ohnehin zum
Einkaufen beliebte Zweibrücken, trotz dortiger Benzinpreisanhebung
"ausgetrocknet".
|
Einige
französische Tankstelleninhaber entdeckten für sich die
Marktwirtschaft. Statt der staatlich vorgegebenen Höchstmenge gaben sie
"unter der Hand" auch mehr Kraftstoff ab, verlangten dafür aber bis zum
Vierfachen des festgesetzten Preises. Manch frustrierter Autofahrer
ließ in der Not
auch die “bessere Hälfte“ um Kraftstoff anstehen, mit dem
ausdrücklichen
Auftrag, den Tankwart zwecks Herausgabe einer kleinen Menge zu
bezirzen. Das
Problem während der Suez-Krise war nicht, wie später in den 70ern, eine
Verknappung der Rohölförderung,
sondern der plötzlich längere Transportweg. Als dann die ersten Tanker
den Weg um
Afrika herum geschafft hatten, floss auch wieder der Kraftstoff.
Nicht
nur bei den Saargruben, sondern auch bei den Hütten, den
Verkehrsbetrieben, vielen Behörden, großen Firmen und bei der Polizei
gab es eigene Tankstellen für Benzin und für Diesel. Superbenzin war
nicht überall zu haben. An einigen dieser Tankstellen konnten auch
Mitarbeiter tanken. Ein Beispiel hierfür ist die "Hüttentankstelle",
die in Völklingen auf dem Schulzenfeld betrieben wurde. Alle Fahrzeuge,
die dort tanken durften, waren erfasst, und die jeweils abgegebene
Kraftstoffmenge wurde notiert. Die Werksfahrzeuge hatten ein Tankbuch,
und der Gegenwert wurde den Belegschaftsangehörigen vom Lohn abgezogen.
Selten gefahren, aber "heftig" gepflegt
Stand bei den Saarländern damals endlich das Wunschauto
vor der Tür, so war oft bereits eine Garage vorhanden; hatte
man doch voraus- schauend die lange Lieferzeit genutzt. Einfach hatten es die Hausbesitzer,
die keinen tiefliegenden Keller hatten, denn dort konnte ein Kellerraum zur
Garage umgebaut werden. Dabei waren die geringe Länge z.B. des
Crèmeschnittchens von nur 3,61 m bei 1,43 m Breite und 1,47 m Höhe vorteilhaft.
Das eigene Auto war wertvoll und sollte, wenn irgendwie
machbar, nicht auf der Straße herumstehen. Geschäftstüchtige Mitbürger kamen
sogleich auf die Idee, freie Plätze in den Städten mit Garagen zu bebauen und
diese zu vermieten.
War
eine Ausfahrt
angesagt, dann bedurfte dies gewissenhafter Vorbereitung, insbesondere
wenn die
Außentemperaturen schon niedrig waren. Die Startautomatik war noch
nicht weit
verbreitet, und der Umgang mit dem Choke wollte gelernt sein, damit der
Motor auch bei Kälte ansprang und bald auch einigermaßen rund lief. Oft
vergaß der Fahrer, dass beim Kaltstart das Gaspedal nicht getreten
werden sollte. Einen Fehler hierbei quittierte der
Motor meist dadurch, dass er überhaupt nicht anspringen wollte. Es gab
auch
ausgewiesene Spezialisten, die den Anlasser dann so lange betätigten,
bis die
Batterie leer und der Motor “abgesoffen“ war. Da konnte dann meist nur
noch der Tankwart
weiterhelfen.
Wenn
das Fahrzeug
längere Zeit gestanden hatte, empfahl fast jede Bedienungsanleitung,
vor einem Startversuch
einen kleinen Hebel an der Benzinpumpe dreimal zu betätigen. Dies war
auch eine
ausgewiesene Spezialität bei Renault. Hier wurde aber andererseits
schon früh eine
über den Auspuff beheizte Startautomatik eingesetzt, und zwar beim 4
CV. Die Peugeot 203- und 403-Fahrer und Fahrerinnen und manch andere
mussten auf diese
Annehmlichkeit verzichten und stattdessen virtuos am Choke ziehen.
In den
Bedienungsanleitungen war zu lesen: "Vor Antritt jeder Fahrt ist der Ölstand zu
prüfen". Es gab auch aus dem Französischen übersetzte Bedienungsanleitungen, die
diese Kontrolle täglich empfahlen. Dies
machte aber bei den üblichen Fahrgewohnheiten der Saarländer keinen
Sinn: Von Montag bis Freitag wurde am Wagen geschraubt, und nicht mit
ihm gefahren. Am Samstag
wurden Fahrzeug und Fahrer geputzt und am Sonntag fand der
Familienausflug mit dem Auto statt.
Eine ordnungsgemäße Wagenwäsche hatte mit dem Gartenschlauch
zu erfolgen und fand meist auf der Straße statt. Fahrzeugbesitzer, die diese
Möglichkeit nicht hatten, frönten der Eimerwäsche und wurden von der
Gartenschlauch-Fraktion angemessen bedauert. Es wurde teilweise verbissen
gepflegt, und matter Chrom galt als Zeichen von Nachlässigkeit oder zeigte an,
dass das Fahrzeug seine besten Jahre längst hinter sich hatte. Auch die Lackpflege
wurde mit großer Ernsthaftigkeit und viel Politur betrieben. Die Besitzer
schwarzer Fahrzeuge waren besonders häufig an der Arbeit. Tat man allerdings
zuviel des Guten, so war der Lack schnell “durchpoliert“. An den Kanten der
Karosserie schimmerte dann die Grundierung durch.
|
Der sorgsame, sparsame Autofahrer achtete darauf, dass die Räder seines Fahrzeugs regelmäßig getauscht wurden. Dabei wurde das
Ersatzrad mit einbezogen - so konnte die Zeit bis zum Kauf eines neuen Satzes
Reifen gestreckt werden. Gekauft wurden dann meist nur vier neue Reifen.
Der
typische Sonntagsausflug führte zu den bekannten lokalen
Ausflugszielen, sie waren ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln meist nur
schwer zu erreichen. Selbst mit dem kleinen 4 CV war ein Ausflug von vier Erwachsenen und drei Kindern nicht ungewöhnlich. Aber
es
wurden durchaus auch
längere Fahrten und Urlaubsreisen unternommen. Dies erforderte bei der
Einreise ins Ausland die Vorlage eines Reispasses als personenbezogenes
Dokument, und für das Auto war als Zolldokument ein "triptyque" notwendig.
Im Triptik bestätigte der ACS (Automobilclub Saar), dass er für das
Fahrzeug gegenüber den Zollbehörden finanziell garantiere, falls
dieses nicht wieder ordnungsgemäß ins Saarland rückgeführt werden
sollte.
|
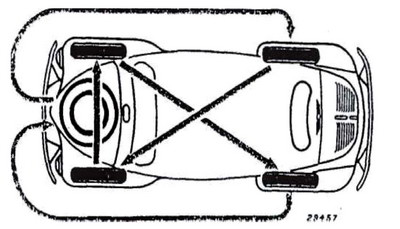
Schema
zum Tausch der Räder. (Werkbild Renault Bedienungsanleitung)
|
|
Ein beliebtes Ziel war,
besonders an den verkaufsoffenen Adventssonntagen, das pfälzische Zweibrücken.
Selbstverständlich stellten sich auch die französischen Zöllner mit intensivierten Kontrollen auf den Einkaufsverkehr ein.
|
 Zur Stärkung auf der Rückfahrt wurde das Gasthaus mit Metzgerei Schwarz in Rentrisch wegen seiner
großzügigen Portionen als Geheimtipp gehandelt. Solche Tipps kursierten für
praktisch alle Strecken. Der Weg nach
Westen führte über Mettlach und den gefürchteten Keuchinger Berg, bei dem
ältere Fahrzeuge oft kochend den vollständigen Aufstieg verweigerten. Deshalb
gab es rechts einen Parkplatz. Der Weg nach Norden führte über Hermeskeil und
die Hunsrück-Höhenstraße, und nach Osten gelangte man bei Kaiserslautern über
die dort beginnende Autobahn. Deren letztes Stück in Richtung Saarland hatten
die Amerikaner für ihre Ramstein-Airbase zweckentfremdet. Diese Autobahn
erlaubte, unmittelbar hinter der Grenze beginnend, den Saarländern schnelles Fahren. Zur Stärkung auf der Rückfahrt wurde das Gasthaus mit Metzgerei Schwarz in Rentrisch wegen seiner
großzügigen Portionen als Geheimtipp gehandelt. Solche Tipps kursierten für
praktisch alle Strecken. Der Weg nach
Westen führte über Mettlach und den gefürchteten Keuchinger Berg, bei dem
ältere Fahrzeuge oft kochend den vollständigen Aufstieg verweigerten. Deshalb
gab es rechts einen Parkplatz. Der Weg nach Norden führte über Hermeskeil und
die Hunsrück-Höhenstraße, und nach Osten gelangte man bei Kaiserslautern über
die dort beginnende Autobahn. Deren letztes Stück in Richtung Saarland hatten
die Amerikaner für ihre Ramstein-Airbase zweckentfremdet. Diese Autobahn
erlaubte, unmittelbar hinter der Grenze beginnend, den Saarländern schnelles Fahren.
Das Bild zeigt das Gasthaus Schwarz in
Rentrisch (Foto von www.rentrisch.de)
|
|
|
Einfacher war die Fahrt nach Südwesten, führte sie doch durch Lothringen und das Elsass. Es waren keine
Grenz- dokumente für das Auto nötig, und eine Zollkontrolle entfiel, zumindest bis zum Rhein.
Die
damaligen französischen Landstraßen waren äußerst gewöhnungsbedürftig,
denn der Belag bestand fast immer aus Rollsplit. Außerdem verliefen sie
meist schnurgerade, aber nur bis zur nächsten Kuppe: Dort konnte die Richtung abrupt wechseln.
Fahrbahn-Markierungen gab es so gut wie keine. Diese Straßen verleiteten zu hoher Geschwindigkeit. Es gab
dort zwar nur wenig Verkehr, aber Unfälle waren, so sie passierten, häufig sehr
schwer.
Wie die Rast auf der Fahrt eines Völklinger Kegelclubs in die Vogesen im Jahr 1951 aussah, zeigt das
Foto rechts:
|

|
|

|
Man sieht dort hinter einem Peugeot 203 einen Renault Juvaquatre, einen Panhard Dyna X
und eine DKW Meisterklasse. Fürsorglich
gönnten die Besitzer ihren Autos eine kleine Abkühlung durch Öffnen der
Motorhauben. Besonders die Mitfahrt in einem DKW war gefürchtet, denn
er hatte eine Neigung zu kochendem Kühlwasser und Pannen aller Art.
Zum Bild links: Hotel-Restaurant
in den Vogesen, davor stehen mehrere Traction Avant.
Vor den Hotels gab es genügend freie
Parkplätze. Kenner bemerken sofort die Pilote-Räder eines der dort
geparkten Traction Avant. In elsässischen Ortschaften konnte man sein
Fahrzeug noch mitten auf dem Platz vor dem obligatorischen Denkmal
abstellen. Die Burgen und Schlösser jenseits der
offenen Grenze und die Weinorte im Elsass waren beliebte Ziele. Auch
der
“große“ Schulausflug per Bus führte oft dorthin. (Diese drei Fotos: privat)
|

Bild rechts: Ein Peugeot 203 aus dem Saarland vor dem Hôtel du Mouton ("Schafs-Hotel") im elsässischen Rappoltsweiler (Ribeauvillé)
Und dann in die Werkstatt
Werkstätten
waren nicht
nur Wartungs-, sondern darüber hinaus Instandsetzungsbetriebe. Was
irgendwie zu
reparieren war, wurde repariert. Defekte Teile wurden, wann immer
möglich, in
der Werkstatt überholt und wieder eingebaut. Austauschteile gab es
nicht, aber Werkstätten, die auf die Überholung von Motoren, Getrieben,
Vergasern, Lichtmaschinen oder Anlassern spezialisiert waren.
Bosch-Dienste waren ganz selten, weil die
elektrische Ausrüstung französischer Fahrzeuge von Cibié, Marchal,
Ducellier
usw. stammte. Die Vergaser waren meist von Solex. Die Spezialisten
hierfür und
Ersatzteilhändler waren ebenfalls in der Nähe der "Saarbrücker
Automeile" zu
finden. Großklos hatte z.B. auch
eine spezielle Motorenwerkstatt außerhalb der Hauptstadt, nämlich in Friedrichsthal. Es gab weitere
Spezialisten wie beispielsweise Karosseriebauer und Lackierbetriebe. Reifenhändler und Runderneuerer
hatten schon immer ihr eigenes Geschäftsfeld.
|

|
Neben den freien
Werkstätten, die oft auf dem Land alles reparierten, was Räder hatte, gab es in
großer Anzahl Vertragswerkstätten, die sich auf mehrere Marken
spezialisiert hatten (siehe links). Die Kunden erwarteten von ihnen auf die jeweilige Marke
besonders geschultes Personal und ein Lager mit häufig benötigten Ersatzteilen.
Werksniederlassungen
wie in der Bundesrepublik gab es nicht. Diese Rolle wurde von den
Importeuren und Großhändlern übernommen. Streckenweise waren deren
Firmennamen ohne Bezug zum Fabrikat, das sie vertraten, wie etwa
Auto-Industrie
für Ford oder Kraftwagen-Handelsgesellschaft Kochte & Rech für
Peugeot. Letztere ging später übrigens in der Werksniederlassung dieser
Marke auf. Renault hatte als
Marktführer ein entsprechend dichtes Werkstattnetz.
|
Anzeige aus dem
Behörden-und Firmenverzeichnis der
Stadt Völklingen 1956
|
In Übereinstimmung mit
den damaligen Anforderungen standen Mechanik und mechanische
Bearbeitungsmethoden in der Werkstatt im Vordergrund. Um überhaupt arbeiten zu
können, waren gewisse bauliche Voraussetzungen notwendig. Da Hebebühnen eine
bestimmte Mindest-Raumhöhe erforderlich machten, war der Standard- Reparaturplatz die Arbeitsgrube.
Von Vorteil war, dass, entsprechende Öffnungen in der Erdgeschossdecke vorausgesetzt, nur wenige weitere Baumaßnahmen
nötig waren. Unter der Werkstatt wurden oft die Wasch- und Umkleideräume für
das Personal Platz sparend untergebracht.
Prüfstand von
Saar-Auto-Contor und Central- Garage mit Renault 4 CV und Opel
Kapitän
Foto: Autohaus Dechent, Saarbrücken
|

|
Selbst der TÜV in Hühnerfeld und
Beckingen hatte
noch Anfang der 60er-Jahre nur Arbeitsgruben. Für einen Radwechsel
waren Hebebühnen zwar ungeheuer praktisch, sie wurden aber aus
Kostengründen durch Rangierheber
ersetzt. Außerdem erforderten Hebebühnen Energie und waren für
Nutzfahrzeuge
kaum zu verwenden.
Unverzichtbar
waren
Drehbank und Autogen-Schweißgerät in der Werkstatt. Jeder Arbeitsplatz
hatte einen schweren Schraubstock. Brems-trommeln, die riefig waren,
wurden nicht
weggeworfen, sondern ausgedreht, Trommelbremsbeläge waren aufgenietet
und
nicht geklebt. Mit dem Schweißgerät wurden festsitzende  Schrauben
und Muttern wieder lösbar gemacht, und manch abgerissener Bolzen wurde
mit ihm verlängert. Auspuffanlagen hat man mit seiner Hilfe repariert
oder aus-
und eingebaut. Neben diversen Schraubenschlüsselsätzen gab es
markenspezifische
Spezialwerkzeugsätze, die meist gut weggeschlossen waren. Eine
besondere Rolle spielte der Drehmomentschlüssel, der gerne das
Meisterbüro zierte. Manche Zylinderkopfdichtung wurde deshalb nicht,
wie vorgeschrieben, mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, sondern von
Hand “nach Gefühl“ angezogen, was sie
meist mit einem kurzen Leben bestrafte. In den größeren Werkstätten gab
es diverse Prüfgeräte für Zündkerzen, Verteiler, Lichtmaschinen,
Batterien. Auch
Kompressionsdruck-Messgeräte hinterließen mit ihrem Messergebnis
bleibenden
Eindruck, wurden die kleinen Diagramme doch gerne der Reparaturrechnung
beigefügt. Große Vertragswerkstätten hatten bereits einen eigenen
Bremsen-Prüfstand und eine
Auswuchtmaschine für die Räder. Trotzdem wurden Bremsentests auch noch
auf der
Straße durchgeführt. Traten bei einer Vollbremsung nur geringe Kräfte
in der
Lenkung auf und waren die Blockierspuren der Hinterräder gleich lang,
so wurde
die Bremse für in Ordnung befunden. Eine periodische, unabhängige
technische
Überprüfung der PKWs fand nicht statt. Schrauben
und Muttern wieder lösbar gemacht, und manch abgerissener Bolzen wurde
mit ihm verlängert. Auspuffanlagen hat man mit seiner Hilfe repariert
oder aus-
und eingebaut. Neben diversen Schraubenschlüsselsätzen gab es
markenspezifische
Spezialwerkzeugsätze, die meist gut weggeschlossen waren. Eine
besondere Rolle spielte der Drehmomentschlüssel, der gerne das
Meisterbüro zierte. Manche Zylinderkopfdichtung wurde deshalb nicht,
wie vorgeschrieben, mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, sondern von
Hand “nach Gefühl“ angezogen, was sie
meist mit einem kurzen Leben bestrafte. In den größeren Werkstätten gab
es diverse Prüfgeräte für Zündkerzen, Verteiler, Lichtmaschinen,
Batterien. Auch
Kompressionsdruck-Messgeräte hinterließen mit ihrem Messergebnis
bleibenden
Eindruck, wurden die kleinen Diagramme doch gerne der Reparaturrechnung
beigefügt. Große Vertragswerkstätten hatten bereits einen eigenen
Bremsen-Prüfstand und eine
Auswuchtmaschine für die Räder. Trotzdem wurden Bremsentests auch noch
auf der
Straße durchgeführt. Traten bei einer Vollbremsung nur geringe Kräfte
in der
Lenkung auf und waren die Blockierspuren der Hinterräder gleich lang,
so wurde
die Bremse für in Ordnung befunden. Eine periodische, unabhängige
technische
Überprüfung der PKWs fand nicht statt.
Foto: Spezialwerkzeugsatz für
die Vorderachse des Traction Avant. (Foto: R. Bräuer)
Die unangenehme
Eigenschaft nahezu aller Fahrzeuge war damals die mangelnde Rostvorsorge der Hersteller.
Bei den bisher weit verbreiteten Fahrzeugen mit Rahmen hatte der Rostfraß
anfangs nicht so gravierende Auswirkungen wie bei den modernen Fahrzeugen mit
selbsttragender Karosserie und den
notwendigen, oft verkleideten, aber mittragenden Schwellern.
Doppelwandige Wagenböden
ließen den Rost im Verborgenen blühen. Die Fahrzeuge wurden grundiert und
lackiert, jedenfalls dort, wo man hinkam. Der Rest wurde des Rostes Beute. Auch der
hinsichtlich Zuverlässigkeit und Qualität viel gelobte Peugeot 403 kann sich
bei den “Schweller-Rostern“ einreihen. Seine “Problemzone“ hatte sich schnell
herumgesprochen. Später lauerten manche Prüfer des TÜV geradezu darauf, mit dem
Schraubenzieher vor den hinteren Kotflügeln auf die 403-Schweller einzustechen. Dabei waren sie häufig erfolgreich.
Auf den Straßen...
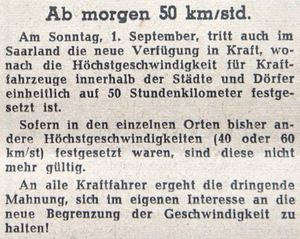
...
ging es rund. Die freie Fahrt, zumindest bis zur Grenze, war den nicht
ganz so freien Saarländern gegönnt. Die seit
Kriegsanfang auf allen Straßen noch geltenden alten deutschen
Tempolimits auf 80 km/h für PKW und 60 km/h für LKW waren schon nach
dem Kriegsende auch im Saarland abgeschafft worden. So wurde also gerne
gerast, was das Fahrzeug hergab. Es gab zwar Strecken mit
Geschwindigkeitsbeschränkungen, auch in Ortschaften, aber Tempo 50 als
allgemein gültige Höchstgeschwindigkeit wurde
erst im September 1957 wie in der gesamten Bunderepublik eingeführt (siehe Zeitungsausschnitt rechts aus der SZ vom 31.8.1957).
Der Straßenzustand war sehr verbesserungsbedürftig, es gab keine Leitplanken, keine Zebrastreifen und kaum Fahrbahnmarkierungen.
Innerhalb der Städte war Kopfsteinpflaster weit verbreitet und oft mit
Straßenbahnschienen garniert. Bei Regen wurde es gefährlich, insbesondere für
die vielen Zweiradfahrer. Motorroller konnten ihr kippeliges Fahrverhalten dann voll ausspielen.
 Noch gefährlicher wurde es bei Dunkelheit. Oft waren Fahrzeuge
mit nur einem Scheinwerfer oder nur einem funktionierender Rücklicht
“einäugig“
unterwegs. Die funzeligen
6-V-Lampen mit mattgelbem Licht nach französischer Art
taten das ihre dazu. Mancher Landwirt brachte die Ernte mit total
unbeleuchtetem
Fuhrwerk nach Hause, und Baustellen waren durch oft genug selbst
verlöschende rote Petroleumlampen nur unzureichend gekennzeichnet. Noch gefährlicher wurde es bei Dunkelheit. Oft waren Fahrzeuge
mit nur einem Scheinwerfer oder nur einem funktionierender Rücklicht
“einäugig“
unterwegs. Die funzeligen
6-V-Lampen mit mattgelbem Licht nach französischer Art
taten das ihre dazu. Mancher Landwirt brachte die Ernte mit total
unbeleuchtetem
Fuhrwerk nach Hause, und Baustellen waren durch oft genug selbst
verlöschende rote Petroleumlampen nur unzureichend gekennzeichnet.
Das Bild zeigt eine Baustelle in der Stengelstraße in Saarbrücken (im Hintergrund erkennt man rechts die Kirche St. Jakob). Foto: Walter Barbian (Saarlandarchiv)
Einige Autofahrer hatten auch dieses oder jenes Bierchen intus. Es gab keine Promillegrenze, und
wer nicht auffällig fuhr oder gar in einen Unfall
verwickelt wurde, verhielt sich nicht strafbar. Eine Verurteilung durch
ein Gericht wegen Trunkenheit am Steuer musste nicht automatisch zum Verlust
der Fahrerlaubnis führen.
Das
Ergebnis war
insgesamt erschreckend: Die Anzahl der Unfälle stieg dramatisch an.
Mitte der
50er-Jahre waren im Durchschnitt jährlich 4,1 von 100 zugelassenen
Fahrzeugen
in Verkehrsunfälle verwickelt. Bei rund 60.000 zugelassenen
Kraftfahrzeugen
waren mehr als 70 Verkehrstote im Jahr zu beklagen. 2011 war die Zahl
der Kraftfahrzeuge
im Saarland auf fast 700.000 angewachsen. Die Anzahl der
Verkehrsunfälle war zwar leicht gestiegen, trotz zehnfacher
Verkehrsdichte betrug sie nun 4,4 pro 100 zugelassener Fahrzeuge, aber
die Zahl der Verkehrstoten war auf 41 gesunken.
Autofahren zur Saarstaatzeit war viel gefährlicher als heute. Denn inzwischen wurden die Straßenverhältnisse massiv verbessert.
Dabei halfen zahlreiche staatliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der
Fortschritt bei der Konstruktion der Fahrzeuge. Die damals am meisten
gekauften Autos hatten Heckantrieb und Pendelachse: das
Crèmeschnittchen in Frankreich und im Saarland, und der VW Käfer in der
Bundesrepublik.
Fahrzeuge dieses Konzepts waren, und das war wichtig, kostengünstig zu
fertigen. Der Nachteil war bekannt, wurde aber weitgehend verschwiegen
oder von
den Käufern mangels erschwinglicher Alternativen hingenommen: Das
Fahrverhalten
war besonders auf nasser Straße problematisch. Fuhr man in einer Kurve
zu
schnell, wurde man schlimmstenfalls vom eigenen Fahrzeugheck überholt
und
landete im Gegenverkehr.
|

|
Dinge
wie aktive
Fahrsicherheit, siehe Heckantrieb und Pendelachse, oder Sicherheit im
Innenraum
standen noch nicht im Vordergrund. Die Armaturenbretter waren aus
bestem Blech
und glatt lackiert. Fahrzeuge hatten sogar noch metallene Haltestangen
an den
Rückenlehnen der Vordersitze, und die Lenksäulen ragten wie
Schaschlikspieße in
den Innenraum. Eines der ersten Fahrzeuge mit gepolstertem
Armaturenbrett und
damit verbesserter Sicherheit für die Insassen war der Peugeot 403.
Sicherheitsgurte
gab es nur in Flugzeugen. Kippschalter mit langen Hebeln galten als
sportlich.
Im Falle eines Unfalls waren die Folgen aber oft entsetzlich. Typisch
waren nach tödlichen Unfällen das vom Fahrer mit letzter Kraft gegen den Aufprall nach vorne durchgebogene Lenkrad und die blutverschmierte Lenksäule. Unfall-Fahrzeuge standen bisweilen
sichergestellt auf den Höfen der Inspektionen der Verkehrspolizei, vielleicht
zur Warnung. Starke Männer behaupteten am Stammtisch, sie könnten sich bei
einem Unfall am Lenkrad abstützen. Sie hatten bestimmt nie die Wracks gesehen.
|
Armaturenbrett eines
Peugeot 403 (Foto:
Snoopy, wiki commons)
|
Problematisch und
unfallträchtig war das Fahren bei Schnee- und Eisglätte. Es gab keine Winterreifen, sondern nur grobstollige "Matsch- und Schnee"-Reifen, die auf wenigen Fahrzeugen gefahren wurden.
Die Verkehrsbetriebe versuchten, irgendwie den Busverkehr aufrecht zu erhalten. Die
Straßen, durch die Omnibuslinien führten, wurden mit Sand und Split,
später auch mit Salz abgestreut. Ein gefährliches Unterfangen für
diejenigen,
die diese Arbeit ausführen mussten. Es gab noch keine speziellen
Streufahrzeuge. Zwei Arbeiter standen hinten an der Bordwand auf den
eingesetzten Lastwagen und verteilten mit Schaufeln das Streugut von
den
langsam fahrenden Fahrzeugen herab auf die Straße. Später wurden
rotierende
Streuer angebaut, die nun ihrerseits weiterhin per Schaufel gefüllt
wurden. Die teilweise
drastischen Salzmengen waren mit verantwortlich für den später
grassierenden
Rostbefall der Autos.
|

Schrottreife Autos auf dem Hof der Polizeikaserne Saarbrücken, um 1957
Foto: Walter Barbian (http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu)
|
|

|
Da
sich das Fahrzeugaufkommen zwischen 1949 und 1954 verdoppelte, kam es
zu massiven
Verkehrs-behinderungen in den Städten während des Berufsverkehrs. Es
waren
außerdem in erheblichem Umfang LKWs unterwegs, die für den Wiederaufbau
unverzichtbar waren. Eine Verkehrsregelung durch Polizisten war an
vielbefahrenen Kreuzungen unumgänglich geworden. So kam der Saarländer
zu “weißen Mäusen“ - das waren Polizisten, die den Verkehr regelten und
weiße Uniformjacken oder lange weiße Mäntel truhen. Nahezu jeder
Saarländer kannte damals die dadurch besser passierbar gemachte
Kreuzung Bahnhofstraße/ Viktoriastraße am so genannten Korn's
Eck in der Landeshauptstadt. Garantierten doch dort zwei oder mehr
Verkehrspolizisten besonders in der
Weihnachtszeit dafür, dass Fußgänger halbwegs ungefährdet, vom
Hauptbahnhof her
kommend, die Geschäfte in der Bahnhofstraße erreichen konnten.
"Weiße Mäuse" Ecke Bahnhofstraße/Viktoriastraße
Foto: Walter Barbian (http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu)
|
An
dieser Kreuzung
wurde sinnvollerweise auch eine der ersten Ampelanlagen installiert,
die die Polizisten über einen grünen Schaltkasten vom sicheren
Bürgersteig aus
steuern konnten. Die Verkehrsampeln waren von SIEMENS, hatten aber nach
französischem Vorbild zusätzliche Ampelsignal-Leuchten im unteren
Mastteil. Diese
waren wahrscheinlich deshalb notwendig, weil man nur mit ihrer Hilfe
die Ampelsignale
aus einem unmittelbar davor haltenden
4 CV beobachten konnte...
Aufgrund der hohen Unfallzahlen blieb die Verkehrspolizei nicht untätig und beschaffte bereits in
den frühen 50er-Jahren ein Geschwindigkeits-Messfahrzeug mit Schweizer Traffipax-Ausrüstung.
Das war der Name der damals allen Autofahrern bekannten
Tempomessgeräte. Gemessen wurde durch Hinterherfahren, dokumentiert per
Foto. Eine
andere Methode zur Überwachung der Geschwindigkeit erfolgte per
Stoppuhr und
Ermittlung der Zeit, die zum Durchfahren einer Messstrecke benötigt
wurde. Die
gefahrene Geschwindigkeit wurde aus einer Tabelle abgelesen. Das
Verfahren war
aufwändig hinsichtlich des Funkgeräte- und Personaleinsatzes. Außerdem
achteten die saarländischen Autofahrer zunehmend auf auffällig am
Straßenrand
postierte Polizisten.
Mehr zum Thema Polizei finden Sie auf unserer Seite Die saarländische Polizei (1945 - 1959)
Wir fahren weiter...
1955 wurde gewählt. Die Entscheidung fiel eindeutig für den
Anschluss an die Bundesrepublik und deren Wirtschaftswunder aus. Zwar fuhr die
Polizei noch über Jahre hinweg Peugeot, aber die deutschen Hersteller sollten
fortan den Markt beherrschen, allen voran VW: Großklos sei Dank. Auch Dechent
verkaufte wieder Opel und Seibert Mercedes. Die Autos wurden immer besser und
immer sicherer, aber auch immer schneller. Es kamen die Sicherheitsgurte, die
Warnblinkanlagen, die grünen Wellen, aber auch die Radarüberwachung und die
Geschwindigkeitsbegrenzungen, nicht zu vergessen die Promillegrenzen. Heute
kann ein Auto mehr Airbags als Sitzplätze haben, und Systeme zur Erkennung von
Verkehrszeichen und Fahrbahnrändern sind bereits auf dem Markt. Sie hätten
damals nicht funktionieren können, weil die notwendigen Markierungen auf den
Straßen fehlten. Es gab noch den nächtlichen "Blindflug" im Elsass und in
Lothringen. Der LKW-Verkehr, im Saarstaat damals unverzichtbar beim Wiederaufbau,
bremst uns heute als internationales “rollendes Lager“ auf der Autobahn aus.
Aus
dem Saarstaat ist am 1. Januar 1957 ein deutsches Bundes und
gleichzeitig ein europäisches Transitland ohne Grenz- und
Zollkontrollen geworden. Die "freie Fahrt für freie Bürger" ist uns
aber aufgrund des stark
angestiegenen Verkehrs unterwegs abhanden gekommen.
|